| Uwe Spörl: Gottlose Mystik in der deutschen Literatur um die Jahrhundertwende. Dissertation Erlangen 1995. Paderborn (Schöningh) 1997 (418 S.). ISBN 3-506-78610-5. |
|
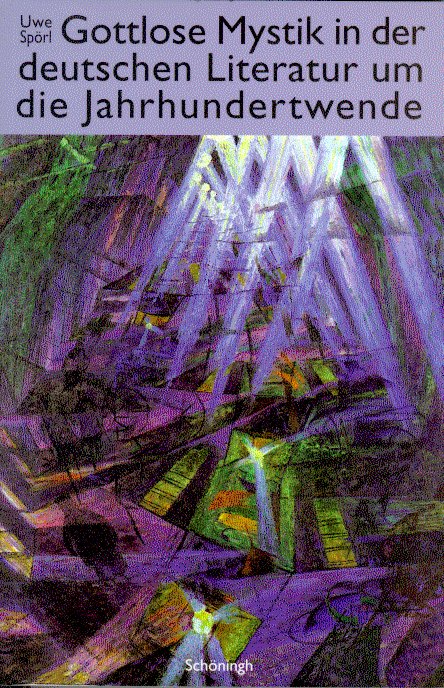 |
Der Waschzettel des Verlages:
Jene »Mystik ohne Gott«, die so typisch für die deutsche Literatur der Jahrhundertwende, ist, steht zugleich für einen allgemeinen kulturellen Zustand Ihrer Zeit, d. h. ihres wissenschaftlichen, sozialen, intellektuellen und literarisch-künstlerischen Lebens. Drei Thesen werden in der vorliegenden Arbeit formuliert und anhand von führenden Theoretikern und Dichtern der Zeit (Nietzsche, Mauthner, Kassner, Heinrich Mann, Musil, Rilke, Hauptmann, Hofmannsthal, Altenberg u. a.) belegt. Die Welt sei dem Menschen und seiner Erkenntnis nicht (mehr) zugänglich. Diese Überzeugung betrifft insbesondere die Möglichkeiten, die man der Sprache und den Wissenschaften zutraut. Diese Verunsicherung führt zu einer nachhaltigen Erkenntnis- und Sprachskepsis. Neue geistige Strömungen (Monismus, Lebensphilosophie) ersetzen alte Religiosität und bilden den bewußtseinsgeschichtlichen Rahmmen für das Phänomen »Neomystik«, in der die imaginierte oder erlebte Einheit der traditionellen Mystik mit Gott auf die entgöttlichte Weit bezogen wird. So soll dem verunsichernden Gefühl der Entfremdung von der Welt begegnet werden. Diese Mystik bedarf - wie die alte Mystik - eines besonderen sprachlichen Ausdrucks und ist daher eng mit literarästhetischen Überlegungen verknüpft und wird Ihrerseits selbst zum Thema von Literatur. |
| Das
Inhaltsverzeichnis:
0 Einleitung 1 Neomystik im Diskurs der Jahrhundertwende 1.1 Mystik, Lebensphilosophie, Neomystik 1.1.1 Mystik in der Literatur um die Jahrhundertwende? 1.2 Erkenntnisskepsis und Sprachskepsis um 1900 1.2.1 Friedrich Nietzsche als Erkenntnis- und
Sprachskeptiker 1.3 Neomystik und andere Einheitskonzeptionen um 1900 1.3.1 Gustav Landauers Wege von der Skepsis zur Mystik 1.4 Nietzsche als Denker und Dichter von Vielheit in der Einheit 1.4.1 Nietzsches Verhältnis zur Mystik 2 Neomystik in der Literatur um die Jahrhundertwende 2.1 Heinrich Manns Novelle »Das Wunderbare«: Neomystisches Erleben und Künstlertum 2.1.1 Heinrich Mann in den 90er Jahren 2.2 Rationalität und neomystisches Erleben: Robert Musils »Verwirrungen des Zöglings Törleß« 2.2.1 Musil zwischen Technik, Philosophie und Kunst 2.3 Rainer Maria Rilke als Dichter von Alleinheit und neomystischem Erleben 2.3.1 Rilke als »mystischer« Dichter 2.4 Gerhart Hauptmann und die künstlerische Phänomenologie der Religiosität 2.4.1 Hauptmanns weltanschaulicher Hintergrund 2.5 Hugo von Hofmannsthals »Chandos-Brief«: Spiel mit dem neomystischen Erlebnis 2.5.1 Landauers Trugschluß 2.6 Peter Altenbergs Skizzenreihe »See-Ufer« aus »Wie ich es sehe«: Wesenserkenntnis an der Erscheinungsoberfläche 2.6.1 Die »Skizzenreihe« »See-Ufer« |
|