1 Einleitung und allgemeine Grundbegriffe
1.1 Sprache als Zeichensystem
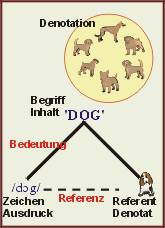 Abb. 1.1. Struktur des sprachlichen Zeichens
Abb. 1.1. Struktur des sprachlichen Zeichens
1.2 Phonetik und Phonologie
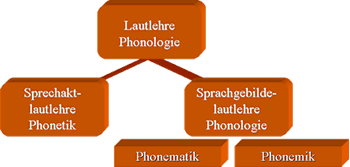
Abb. 1.2. Phonologie
Die beiden Bezeichnungen Phonetik und Phonologie sind aus dem
griechischen Wort φψνή (pho:ne:)
abgeleitet, welches 'Laut, Stimme' bedeutet. Die beiden wissenschaftlichen Disziplinen
Phonetik und Phonologie haben
also etwas mit Lauten zu tun, und zwar mit solchen Lauten, die von Menschen mithilfe
ihrer Sprechwerkzeuge hervorgebracht werden, und als Bestandteil menschlicher gesprochener
Sprache fungieren können. In der traditionellen Grammatik werden diese Teilgebiete
analog zu den anderen sprachwissenschaftlichen Teilgebieten wie Wortlehre (Morphologie),
Bedeutungslehre (Semantik) oder Satzlehre (Syntax) unter der Bezeichnung
Lautlehre abgehandelt. Lautlehre ist nach einer Wörterbuchdefinition
die "Wissenschaft von den Lauten, ihrer Erzeugung in den Sprechwerkzeugen, ihrer
Entwicklung und Geschichte (Phonetik) u. ihrer Funktion in den sprachlichen Systemen
(Phonologie) als Teilgebiet der Sprachwissenschaft."
Die Bezeichnung Phonologie wird in zwei Bedeutungen verwendet,
einmal als Synonym für Lautlehre insgesamt, einmal für die Teildisziplin, die sich
mit der "Funktion von Lauten in den sprachlichen Systemen" beschäftigt.
[Bezug auf Trubetzkoy 1958]
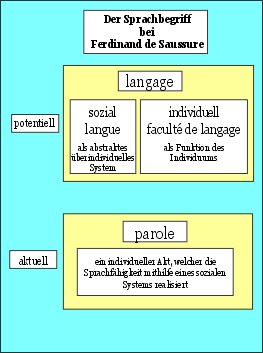
Abb. 1.3. Der Sprachbegriff bei Saussure
Aufgabe der Phonetik ist es, jene Laute zu beschreiben
und zu klassifizieren, die durch den menschlichen Sprechapparat hervorgebracht werden
können, wobei sich die Beschreibung und die daraus resultierende Klassifikation
nicht auf Einzelsprachen beschränkt sondern quasi das gesamte Potential menschlicher
Lautproduktion zu erfassen sucht. Die Klassifikation von Lauten erfolgt weitgehend
über die Beschreibung der physiologischen Mechansimen, die zur Bildung dieser Laute
nötig sind. Dazu wird untersucht, wie das Zusammenspiel verschiedener Körperteile,
also z.B. der Lunge, des Kehlkopfes, der Zunge etc., zur Bildung eines Lautes führt.
Die Phonologie hingegen befaßt sich mit der Verwendung
von Lauten in der menschlichen Sprache und also in Einzelsprachen. Es wird untersucht,
wie sich einzelne Sprachen bestimmte Laute zunutze machen, wie diese Laute in einer
Sprache verteilt sind und welche Funktion sie in dieser Sprache haben. Das Ziel
dabei ist u.a., die in einer Sprache vorkommenden phonologischen Gesetzmäßigkeiten
zu ermitteln und somit das der Sprache zugrunde liegende Lautsystem zu entschlüsseln.
Die Untersuchung der Bildung von Lauten einerseits und der Lautstruktur von Sprache
oder einer Einzelsprache andererseits ist keine abgehobene, abstrakte Beschäftigung.
Beide Fachrichtungen sind wissenschaftliche Disziplinen, die eng an konkretem Material
arbeiten und deren Erkenntnisse einer ganzen Reihe von Tätigkeitsfeldern zugute
kommen.
Im Bereich der Patholinguistik, einem Zweig der angewandten Linguistik, der sich
mit Theorie, Diagnose und Therapie von Sprach- und Sprechstörungen befaßt, erfordert
beispielsweise die Diagnostik und Behandlung von Artikulationsstörungen genaue Kenntnisse
über den Aufbau und die Funktion der menschlichen Sprechorgane. Um eine Störung
akkurat zu erkennen und eine geeignete Therapie einzuleiten, um z.B. entscheiden
zu können, ob die Störung anatomische Ursachen hat oder nicht, ist phonetisches
Wissen unabdingbar.
Ein weiteres Gebiet, in welchem es auf phonetische und phonologische Kenntnisse
ankommt, ist die maschinelle Verarbeitung gesprochener Sprache. Das gilt gleichermaßen
für die Erzeugung wie für die Analyse gesprochener Sprache. In diesem Bereich sind
in neuerer Zeit beachtliche Fortschritte gemacht worden, so gibt es z.B. Diktiersysteme,
die über automatische Spracherkennung kontinuierlich gesprochenen Text direkt in
geschriebenen Text umsetzen können. Bei der Entwicklung solcher Systeme spielt phonetisches
(in diesem Fall auch aus der akustischen Phonetik, s.u.) und phonologisches Wissen
eine große Rolle. Allein für die Analyse der komplexen Beziehung zwischen Aussprache
und Schreibweise von sprachlichen Einheiten ist eine fundierte Kenntnis der phonologischen
Struktur der jeweiligen Sprache notwendig.
Ein großes Anwendungsgebiet für Phonetik und Phonologie ist natürlich das Gebiet
des Fremdsprachenlernens und -lehrens. Als Lehrer/Lehrerin im Fremdsprachenunterricht
sollte man nicht nur in der Lage sein, Aussprachefehler von Schülern zu erkennen,
sondern auch, diese Fehler angemessen zu korrigieren. Bei bestimmten, in der Muttersprache
nicht vorkommenden Lauten, können bei der Aussprache Probleme auftauchen. In solchen
Fällen ist es nützlich, zu wissen, wie diese Laute gebildet werden, um so konkrete
Hinweise zur Aussprache geben zu können.
Wenn man sich beruflich bzw. während des Studiums mit Sprache oder einer Einzelsprache
auseinandersetzen muß, sind phonetische und phonologische Grundkenntnisse selbstredend
unerläßlich. Eine der wichtigsten Quellen der Linguistik, nämlich die gesprochene
Sprache, würde ohne phonetische Kenntnisse unzugänglich sein, dann hätten auch phonologische
Regeln und somit ein wichtiger Bestandteil vieler Grammatiken an Sinn verloren.
Der englische Philologe, Linguist und Phonetiker Henry Sweet, der das Vorbild für
die Figur des Professor Higgins in G.B. Shaw's Stück Pygmalion abgab, beschrieb
die Phonetik vor mehr als 100 Jahren als "... the indispensable foundation of all
study of language whether that study be purely theoretical, or practical as well..."
(Sweet 1877: v).
[Ausführungen zu "Aussprache"]
1.3 Phonetik
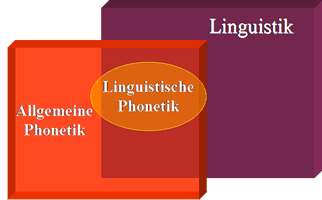
Abb. 1.4. Linguistische Phonetik
Im weitesten Sinne befaßt sich die Phonetik mit allen Schallereignissen, die durch
die menschlichen Sprechorgane erzeugt werden können, und zwar unabhängig davon,
ob oder wie diese als systematische Sprachlaute in einer Sprache vorkommen. Dafür
verwenden wir die Bezeichnung Allgemeine Phonetik. Die
allgemeine Phonetik hat sich zu einer eigenständigen eher naturwissenschaftlichen
Disziplin entwickelt, die in ihre Forschung andere Disziplinen wie z.B. Physik,
Mathematik, Physiologie, Psychologie und Informatik einbezieht.
In einem engeren, und für uns relevanten Sinne ist die Phonetik die Wissenschaft,
die jene Lautgebilde untersucht, die als Bestandteile der menschlichen Sprache bzw.
einer Einzelsprache fungieren. In diesem Sinn ist Phonetik also ein Teilgebiet der
Linguistik, dem Fachgebiet, dessen Gegenstand die menschliche Sprache als Ganzes
ist. Für diese Art der Phonetik wird der Begriff Linguistische Phonetik
verwendet. Wenn im weiteren Verlauf des Skripts die Rede von Phonetik ist, ist damit
eben diese linguistische Phonetik gemeint. Die linguistische Phonetik kann als Durchschnitt
der allgemeinen Phonetik und der Linguistik gesehen werden (s. Abb. 1.4).
1.4 Phonologie
Während die Phonetik Sprachlaute unter einem physiologisch-akustischem Aspekt betrachtet,
untersucht die Phonologie Sprachlaute unter einem linguistischen Aspekt. Das soll
bedeuten, daß in der Phonologie untersucht wird, auf welche Art und Weise das menschliche
Lauterzeugungspotential in einzelnen Sprachen ausgeschöpft wird und welche phonologischen
Gesetzmäßigkeiten für diese Sprachen gelten. Der Gegenstand der Phonetik ist die
Lautsubstanz, der Gegenstand der Phonologie ist die Lautform. Für die beiden Begriffe Substanz und Form finden
sich bei Crystal (1980) die folgenden Definitionen:
Definition 1.1. Substanz (engl. substance )
Der Terminus Substanz bezieht sich auf das undifferenzierte konkrete Rohmaterial
aus dem Sprache aufgebaut ist, d.h. die Schallwellen der Rede (phonische Substanz)
bzw. die sichtbaren Merkmale der "Schreibe" (graphische Substanz).
Definition 1.2. Form
Der Terminus Form meint die abstrakten Strukturen oder Relationsgeflechte,
die der Substanz durch die Sprache "übergestülpt" werden. Die Substanz
wird durch die Sprache geformt und in Einzelsprachen in je spezifischer Weise.
Mit Substanz ist hier ganz wörtlich der materielle Stoff gemeint, aus dem
Sprache besteht: aus Schallwellen bei gesprochener Sprache, aus Schriftzeichen bei
geschriebener Sprache. Natürlich kommt diese Substanz nicht unabhängig von einer
bestimmten Form, also einer bestimmten Sprache, vor. Ist den Rezipienten, also den
Hörern bzw. Lesern, diese Form allerdings unbekannt, wie es bei einer 'fremden',
z.B. nicht derselben Sprachfamilie wie die Muttersprache angehörenden Fremdsprache
der Fall ist, so verbleibt bei der Perzeption nur die Substanz, die ohne Kenntnis
der Form uninterpretierbar ist.
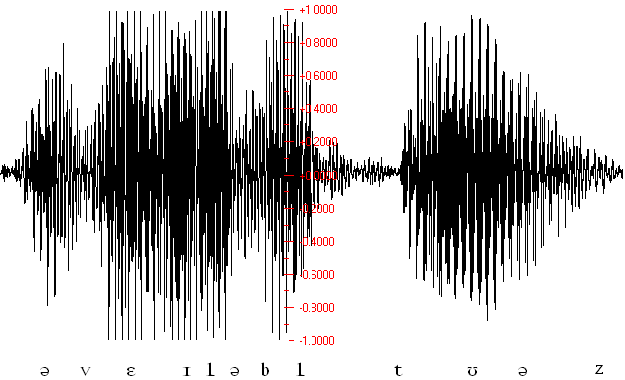
Abb. 1.5.
Wellenform des Sprachausschnitts available to us [ə'vɛiləbl
tʊ əz] aus einer Sprachaufnahme von Noam Chomsky.
Während für die Phonetik alle Eigenschaften von Sprachlauten relevant sind, befaßt
sich die Phonologie primär mit deren linguistischen Funktionen. Deshalb kann die
Phonologie auch als funktionale Phonetik bezeichnet werden. Die Hauptaufgabe und
Funktion von Sprachlauten ist es, der Identifikation linguistischer Einheiten zu
dienen. Mit linguistischer Einheit sind hier Morpheme, Wörter, Sätze usw. gemeint.
Um diese Einheiten identifizieren zu können, müssen sie voneinander unterscheidbar
sein, und diese Unterscheidbarkeit wird durch Sprachlaute gewährleistet. Die Frage
nach Unterschieden und Kontrasten ist in diesem Kontext für die Linguistik also
sehr bedeutsam. Die Phonetik untersucht dabei hauptsächlich Unterschiede in der
Lautsubstanz, welche für die Phonologie insbesondere dann eine Rolle spielen, wenn
ein entsprechender Unterschied in der Funktionalität und also in der Lautform vorliegt.
Diese Aussagen können durch ein Beispiel illustriert werden. Der Vergleich der beiden
englischen Wörter pit und bit zeigt, daß der Unterschied in der
lautlichen Substanz des jeweiligen Anlautes liegt. Die Verwendung von p
einerseits und b andererseits emöglicht es, diese beiden Wörter von einander
zu unterscheiden. Phonetisch gesehen liegt der Hauptunterschied zwischen p
und b darin, daß die Stimmbänder bei der Produktion des b schwingen,
während dieses beim p nicht der Fall ist. Dieser Unterschied taucht übrigens
in einer ganzen Reihe von Wortpaaren auf, wie z.B. tin:din, chin:gin, oder
call:gall. Ein weiteres Merkmal von p ist, daß es "behaucht" ist,
d.h. daß die Aussprache dieses Lautes mit einem spürbaren Ausstoßen von Luft einhergeht.
Dieses Merkmal wird Aspiration genannt. Das Merkmal der
Aspiration taucht in einer phonetischen Beschreibung von p mit Sicherheit
auf. Phonologisch betrachtet, also in bezug auf Unterschiede und Kontraste linguistischer
Einheiten, spielt die Aspiration in diesem Fall aber keine große Rolle: Selbst wenn
das p nicht aspiriert ausgesprochen würde, wäre der Unterschied zwischen
dem p von pit und dem b von bit noch groß genug,
um diese beiden Wörter voneinander zu unterscheiden.
In der Lautstruktur der englischen Sprache hat die Aspiration keinen funktionalen
Status und würde deshalb auch nur untergeordnet in einer phonologischen Beschreibung
des Englischen vorkommen. Daran wird deutlich, daß sich die Phonologie auf einer
abstrakteren Ebene mit Lauten auseinandersetzt als die Phonetik: Es kommt bei der
Phonologie nicht auf alle, sondern eben auf die funktionalen bzw. distinktiven Merkmale
von Lauten an. Die Grundeinheiten, mit denen in der Phonologie gearbeitet wird,
bestehen jeweils aus der Summe der funktionalen bzw. distinktiven Merkmale eines
Lautes. Eine solche abstrakte Grundeinheit heißt Phonem.
Phoneme werden typographisch durch Schrägstriche gekennzeichnet: /p/.
Das nächste Beispiel zeigt, daß unter bestimmten Voraussetzungen auch nicht-distinktive
Eigenschaften Bestandteil der phonologischen Beschreibung einer Sprache sind:
Die lautlichen Repräsentationen der beiden englischen Wörter leaf und feel
unterscheiden sich zunächst nur dadurch, daß die Phoneme, aus denen sie bestehen,
in umgekehrter Reihenfolge stehen: /l/,/i:/ und /f/ für leaf bzw. /f/,
/i:/ und /l/ für feel. Es besteht aber auch ein Unterschied in der Art,
in der das /l/ ausgesprochen wird. In der Tat gibt es für das englische Phonem /l/
mehrere Aussprachevarianten. Das /l/ aus leaf wird als "helles L" bezeichnet,
das /l/ aus feel als "dunkles L". Diese phonetisch eindeutige Unterscheidung
spielt funktional betrachtet keine große Rolle: selbst wenn das englische feel
mit einem "hellen L" gesprochen würde, was dann so klänge wie das deutsche Wort
viel, wäre die Bedeutung im Kontext klar interpretierbar. So gesehen ist
dieser Unterschied phonologisch irrelevant. Die Aussprache von feel mit
"hellem L" ist aber nicht englisch-authentisch, d.h. daß Sprecher, die die Unterscheidung
zwischen "hellem L" und "dunklem L" nicht berücksichtigen, mit Akzent sprechen.
Das spricht dafür, diesen Unterschied in einer phonologischen Beschreibung zu berücksichtigen.
Ein weiteres Argument dafür ist in der Tatsache begründet, daß die
Distribution der beiden Formen gesetzmäßig ist: das "dunkle L" steht
am Ende eines Wortes oder Morphems oder vor einem anderen Konsonanten: ball, killed,
hilt, das "helle L" an allen anderen Positionen. Die Unterscheidung der
beiden Aussprachevarianten des Phonems /l/ kann also mit Bezug auf deren Distribution
getroffen werden, also mit Bezug auf die Position, die sie in einer linguistischen
Einheit haben. Das heißt, daß diese Unterscheidung in bezug auf die linguistische
Form und nicht auf die Substanz getroffen wird. In einem solchen Fall gehören auch
nicht-distinktive Merkmale zur phonologischen Beschreibung.
1.5 Zweige der Phonetik
 Abb. 1.6. Lautliche Kommunikation
Abb. 1.6. Lautliche Kommunikation
Die Graphik in Abb. 1.6. illustriert unterschiedliche Teilaspekte der lautlichen
Kommunikation: Lautproduktion, Lautübertragung und Lautwahrnehmung. Diese verschiedenen
Aspekte korrespondieren mit den Gegenständen unterschiedlicher Zweige der Phonetik.
Wie wir sehen werden, bietet jeder dieser Zweige potentiell die Möglichkeit, Sprachlaute
zu klassifizieren.
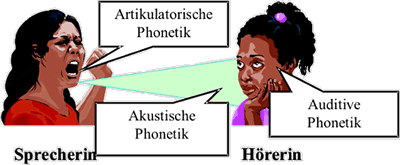 Abb. 1.7. Zweige der Phonetik
Abb. 1.7. Zweige der Phonetik
1.5.1 Artikulatorische Phonetik
Die Artikulatorische Phonetik, auf welche in diesem Kurs
der Schwerpunkt gelegt ist, untersucht Sprachlaute unter dem Aspekt der Lautproduktion.
Bei diesem Zweig der Phonetik geht es also um die physiologischen Prozesse, die
sich bei der Artikulation vollziehen. Die artikulatorische Phonetik hat eine lange
Tradition, da die Lautproduktion und bestimmte Aspekte der Lautperzeption zu den
zugänglichsten Aspekten der Phonetik gehören. So wurden schon in der Antike Sprachlaute
über Höreindrücke und die Beschreibung der Stellung der Artikulationsorgane klassifiziert.
Die im internationalen phonetischen Alphabet verwendete Klassifikation von Lauten
basiert ebenfalls auf Artikulationsmerkmalen.
1.5.2 Akustische Phonetik
Die akustische Phonetik untersucht Sprachlaute unter dem Aspekt der Lautübertragung,
d.h. ihr Gegenstand ist die physikalisch-akustische Struktur von Sprachlauten.
Die akustische Phonetik, durch die eindeutige und objektiv meßbare Analysen der
Sprachlaute erbracht werden können, gehört eher der allgemeinen Phonetik denn der
linguistischen Phonetik an. Im Vergleich zur artikulatorischen Phonetik ist die
akustische Phonetik eine relativ junge Disziplin. Das liegt an der Tatsache, daß
die für dieses Fach notwendigen technischen Hilfsmittel wie z.B. Spektrographen
auch erst in neuerer Zeit entwickelt wurden. In diesem Bereich werden Laute über
ihre physikalischen Eigenschaften, unter anderem ihrer Frequenz, klassifiziert.
Im Hinblick auf die maschinelle Verarbeitung gesprochener Sprache (d.h. Analyse
und Synthese gesprochener Sprache) gewinnt die akustische Phonetik zunehmend an
Bedeutung: Da Maschinen weder über die Sprechwerkzeuge (Kehlkopf, Zunge, Zähne usw.)
noch über ein menschliches Gehör und die mit der Wahrnehmung von Lauten verbundenen
Empfindungen verfügen (Zischlaut, Schnalzlaut etc.), ist die physische
Seite der Lautschallwellen in diesem Zusammenhang besonders wichtig.
1.5.3 Auditive Phonetik
Die Auditive Phonetik beschäftigt sich mit Sprachlauten
unter dem Aspekt der Lautperzeption. Dabei werden die anatomischen und neuro-physiologischen
Prozesse bei der Wahrnehmung von Sprachlauten untersucht.
Dieses Teilgebiet der Phonetik beschäftigt sich einerseits mit der für die Lautwahrnehmung
relevanten Anatomie des Gehörs, andererseits mit der Dekodierung oder dem Verstehen
und Verarbeiten des Wahrgenommenen im Gehirn. Individuelle Wahrnehmung und subjektive
Lautempfindung bestimmter Laute (Laute werden differenziert durch Kontraste wie
z.B. "hart - weich", "hell - dunkel") bieten keine gute Basis für die Klassifikation
von Sprachlauten. An späterer Stelle wird jedoch deutlich, daß die Beschreibung
bestimmter Aspekte von Lautstrukturen zumindest teilweise auf dem subjektivem Erkennen
der Beziehungen zwischen Lautempfindungen basiert.
Obwohl die drei genannten Zweige der Phonetik allesamt auf vielfältige Weise zur
linguistischen Untersuchung gesprochener Sprache beitragen, ist es doch die artikulatorische
Phonetik, die in der linguistischen Phonetik am einflußreichsten ist; folglich werden
wir uns in diesem Kurs auch primär mit diesem Teilbereich beschäftigen.
1.6 Phasen der Sprachproduktion
Sprechen ist die primäre Form menschlicher Kommunikation und erfüllt somit eine
wesentliche soziale Funktion. Für unsere Zwecke definieren wir die Funktion gesprochener
Sprache als Medium zur übermittlung von Information(en). Die Erzeugung der gesprochenen
Sprache ist dabei ein komplexer Prozeß, welchen man in verschiedene Stadien aufteilen
kann. Eine Aufteilung dieses Prozesses ist keine neue Erfindung, schon Grammatiker
des alten Indien haben unterschiedliche Stadien beschrieben:
The soul, apprehending things with the intellect, inspires the mind with a desire
to speak; the mind then excites the bodily fire which in its turn impels the breath.
The breath, circulating in the lungs, is forced upward and, impinging upon the head,
reaches the speech-organs and gives rise to speech sounds. (Zitiert aus Catford 1977: 2)
Das erste dieser Stadien, "apprehending things with the intellect", also das Erkennen
oder Erfassen der Information, die übermittelt werden soll, liegt natürlich jenseits
des Zugriffs phonetischer Untersuchungen. Davon abgesehen können die folgenden Phasen
unterschieden werden (Catford 1977: 2ff.; 1988: 3ff.):
|
|
|
Klicken Sie das Bild um eine Authoware-Sequenz zu starten. Achtung: Es wird vorausgesetzt,
dass ein Authorware Plug-In installiert ist.
|
- Neurolinguistische Programmierung
- Die neuromuskuläre Phase
- Die organische Phase
- Die aerodynamische Phase
- Die akustische Phase
- Die neurorezeptive Phase
- Die neurolinguistische Identifikation
Diese Phasen sollen in den folgenden Abschnitten kurz erläutert werden.
1.6.1 Neurolinguistische Programmierung
In der ersten Phase werden die grammatischen, lexikalischen, phonologischen und
phonetischen Merkmale, die die zu übertragende Information enthalten, als eine Art
neurales (=die Nerven betreffendes) Programm enkodiert. Dieses Programm steuert
die Auswahl, die Abfolge und das Timing der nun einsetzenden neurophysiologischen
Ereignisse.
1.6.2 Neuromuskuläre Phase
In dieser Phase werden die durch das neurale Programm vorgebenen motorischen Impulse
über verschiedene Nervenleitungen als Muskelreize in den Brustkorb, die Kehle, den
Mund usw. weitergegeben. Diese Muskelreize führen zur Bewegung (Kontraktion und
Entspannung) bestimmter Muskeln oder Muskelpartien.
1.6.3 Organische Phase
Als Folge der Kontraktion und Entspannung bestimmter Muskeln und Muskelpartien nehmen
die damit verbundenen Sprechorgane bestimmte Stellungen ein oder vollziehen bestimmte
Bewegungen. Da es sich in diesem Stadium nicht mehr um einzelne Muskeln bzw. Muskelpartien
handelt, sondern um ganze Sprechorgane, wie die Lunge, den Kehlkopf, die Zunge usw.,
nennt man diese Phase organische Phase.
1.6.4 Aerodynamische Phase
Die unterschiedlichen Stellungen und Bewegungen, die die Sprechorgane während der
dritten Phase einnehmen bzw. vollziehen, führen dazu, daß sich die physische Form
des Ansatzrohres ändert. Dieses wiederum hat zur Folge, daß die im Ansatzrohr vorhandene
Luft komprimiert oder ausgedehnt wird, und sich somit in ständiger Veränderung befindet.
Diese Phase ist die aerodynamische Phase.
1.6.5 Akustische Phase
In dieser Phase geht es um die übertragung der in der aerodynamischen Phase erzeugten
wahrnehmbaren Schallwellen. Die übertragung der Schallwellen verläuft dabei eigentlich
auf zwei Ebenen: zum einen werden sie über das Medium Luft von dem Mund des Sprechers
zu den Ohren aller, die sich in Hörweite befinden, übertragen. Das beinhaltet also
auch die Ohren des Sprechers selbst. Zum anderen werden die Schallwellen über den
Schädel des Sprechers zu dessen Ohren übertragen. [Dieser wichtige Aspekt der akustischen
Phase, genannt Feedback, wird weiter unten wieder aufgegriffen.]
1.6.6 Neurorezeptive Phase
Wenn die Schallwellen auf das Ohr des Hörers treffen, werden eine ganze Reihe neurophysiologischer
Prozesse in Gang gesetzt, deren Summe die neurorezeptive Phase konstituieren.
1.6.7 Neurolinguistische Identifikation
Im Anschluß an die neurorezeptive Phase und als Ergebnis dieser findet beim Hörer
ein weiterer, interpretativer (im Sinne von 'übersetzender') Prozeß statt, in welchem
die empfangenen neurorezeptiven Signale als bestimmter Laut oder bestimmte Lautsequenz
erkannt werden. Diese Phase entspricht quasi der Umkehrung der ersten Phase und
kann als Phase der neurolinguistischen Identifikation bezeichnet werden. Anzumerken
ist, daß die tatsächliche Dekodierung des Gehörten nicht in diese Phase fällt, der
Verstehensprozeß von gesprochener Sprache liegt wiederum jenseits phonetischer Untersuchung.
1.7 Rückkopplung
Die Aufteilung des Prozesses des Sprechens in einzelne Phasen darf nicht darüber
hinwegtäuschen, daß diese Phasen eng aneindergekoppelt sind und ein zusammenhängendes,
ineinanderfließendes Ganzes bilden. Das Sprechen ist auch ein selbstgesteuerter
und -geregelter Prozeß, bei dem die Rückkopplung ein wichtiges Kriterium ist. Das
bedeutet, daß Sprecher während des Sprechvorganges auch immer selbst ihr Sprechen
wahrnehmen und kontrollieren. Wie wichtig diese Rückkopplung ist, wird immer dann
offensichtlich, wenn sie, und somit die Steuerung des Sprechvorganges, gestört ist.
Das passiert unter dem Einfluß von Alkohol oder Drogen, oder durch anatomische Ursachen
wie z.B. die Schädigung des Gehörs oder durch Taubheit. Der Prozeß, mithilfe dessen
Sprecher während des Sprechvorgangs ihr Sprechen wahrnehmen können, heißt
Rückkopplung.
Dabei nun kann man zwischen zwei unterschiedlichen Arten unterscheiden. Die eine
Art ist bereits weiter oben angesprochen worden: Die beim Sprechen entstehenden
Schallwellen werden über die Luft und über die Schädelknochen auf daß Gehör der
Sprecher übertragen, d.h. sie hören sich praktisch selbst. Dieses nennt man auditive Rückkopplung.
Die andere Art der Rückkopplung hat damit zu tun, daß Sprecher die Bewegungen spüren,
die die beim Sprechvorgang aktiven Sprechwerkzeuge und Muskeln vollziehen. Diese
Rückkopplung, auch kinaesthetische Rückkopplung genannt,
kann unter bestimmten Bedingungen zum Erliegen kommen, z.B. nach einem Zahnarztbesuch,
bei dem man Betäubungsspritzen bekommen hat. In einer solchen Situation hat man
sowohl die Kontrolle als auch das Rückkopplung der beeinträchtigten Mundpartien
verloren, und die Steuerung des Sprechvorgangs ist gestört.
Mithilfe dieser Prozesse und der dadurch gewonnenen muskularen, organischen, aerodynamischen
und akustischen Informationen ist es möglich, den Sprechvorgang während des Ablaufes
zu kontrollieren. Normalerweise verlaufen diese Rückkoppelungsprozesse im Unterbewußtsein;
eine Aufgabe der phonetischen Schulung besteht darin, sie bewußt zu machen.
1.8 Segmente, Kategorien und Merkmale
Linguistische Einheiten wie Wörter, Morpheme, Phrasen etc. sind sprachliche Zeichen,
welche sich, wie andere Zeichen auch, aus einer Inhaltsseite
und einer Ausdrucksseite zusammensetzen. In in diesem
Zusammenhang spricht man auch von der Zuordnung eines Inhaltes zu einem Ausdruck.
Mit Inhalt ist dabei (umgangssprachlich) die Bedeutung eines Zeichens gemeint,
Ausdruck bezieht sich auf die Form dieses Zeichens, bei gesprochenen sprachlichen
Zeichen also Sprachlaute. In der Zeichenlehre werden unterschiedliche Komplexitätsgrade
von Zeichen unterschieden, so kann die Kombination mehrerer einfacher Zeichen ein
neues, komplexes Zeichen erzeugen. Dies trifft auch auf linguistische Einheiten
zu, beispielsweise können Sätze als komplexe Zeichen aufgefaßt werden. Wie eingangs
bereits gesagt, besteht die Funktion von Sprachlauten darin, den Hörern zu ermöglichen,
unterschiedliche linguistische Einheiten und Kombinationen dieser Einheiten zu identifizieren.
In der Muttersprache (oder ggf. einer aus derselben Sprachfamilie stammenden Sprache)
ist das eine einfache Angelegenheit. Bei einer fremden Sprache sieht das schon ganz
anders aus; so ist es z.B. für Sprecher, die arabische Sprachen nicht kennen, sehr
schwierig, beim Hören einer solchen Sprache überhaupt zu erkennen, welche der verwendeten
Lautkombinationen Wörter oder Phrasen sind, und wo ein Satz anfängt bzw. wieder
aufhört. (Für Sprecher, die nicht in germanischen Sprachen geschult sind, taucht
dasselbe Problem natürlich beim Hören des Englischen oder Deutschen auf.)
1.8.1 Phonetische Segmente
Wie der zuletzt angesprochen Punkt verdeutlichen soll, handelt es sich bei der gesprochenen
Sprache um ein Kontinuum. Ein Blick auf die Wellendarstellung eines gesprochenen
Satzes untermauert diese Feststellung.
Beispiel
Auch von einem physiologischen Standpunkt aus kann diese Aussage erhärtet werden:
während des Sprechvorgangs befinden sich die betroffenen Sprechwerkzeuge in ständiger
Bewegung. Dennoch werden diese Lautkontinua in Segmente eingeteilt, ein Lautkontinuum
wird also beim Hören als eine Sequenz von Lautsegmenten wahrgenommen. Es stellt
sich die Frage, wie denn die Segmentierung eines Lautkontinuums vorgenommen werden
kann, wie man also etwas, das lückenlos zusammenhängt, in einzelne Elemente einteilen
kann. Die Anwort lautet: es wird nur darauf geachtet, in welchen Extrempositionen
sich die Sprechwerkzeuge befinden; die übergänge zwischen diesen Extrempositionen
bleiben unberücksichtigt. Dazu ein Beispiel: Ein Wort wie Atta ist ein
lückenloser übergang von einer maximalen öffung /a/ zu einem völligen Verschluß
/t/ und wieder zu einer maximalen öffnung /a/. Dieser übergang findet kontinuierlich
statt, die Sprechwerkzeuge vollziehen dabei eine fließende Bewegung. Für die Segmentierung
allerdings sind nur die eben genannten Extrempositionen maximale öffnung - totaler
Verschluß relevant; die übergangsbewegungen werden außer Acht gelassen. Als Ergebnis
einer solchen Segmentierung verbleiben dann Einheiten, die umgangssprachlich in
etwa den Konsonanten und Vokalen entsprechen.
Definition 1.3. Segment
Die kleinsten identifizierbaren sequentiellen Einheiten der Sprache heißen Segmente.
Eigenschaften, die sich nur auf eines dieser Segmente beziehen, heißen segmental.
Der zweite Satz dieser Definition ist vielleicht erklärungsbedürftig; man muß dabei
im Auge behalten, daß eine Lautsequenz auch als Ganzes bestimmte Eigenschaften hat,
die über die Ausdehnung eines einzelnen Segments herausgehen. Diese Eigenschaften,
die suprasegmental genannt werden, beinhalten Merkmale
wie z.B. den Tonhöhenverlauf einer Lautsequenz.
1.8.2 Phonetische Merkmale
Die Lautsegmente einer Sprache können auf der Basis gemeinsamer phonetischer Eigenschaften
zu Klassen zusammengefaßt werden. Eine solche Klasse heißt phonetische
Kategorie.
Definition 1.4. phonetische Kategorie
Eine phonetische Kategorie ist eine Klasse von Lautsegmenten, die eine oder mehrere
phonetische Eigenschaften teilen.
Wir erinnern uns an das Beispiel mit dem Wortpaaren pin:bin, tin:din,
chin:gin, fine:vine, thigh:thy,
seal:zeal, call:gall. Der Vergleich der Anlaute
des jeweiligen Wortpaares ergab, daß beim Anlaut des ersten Wortes die Stimmbänder
nicht schwingen, während dies beim Anlaut des zweiten Wortes der Fall ist. Somit
sind die Segmente p, t, k, f, s...
Elemente derselben phonetischen Kategorie: Das gemeinsame phonetische Merkmal ist,
daß die Stimmbänder bei der Erzeugung dieser Laute nicht schwingen. Ebenso bilden
die Segmente b, d, k, v, z... eine
phonetische Kategorie; bei diesen Lauten geraten die Stimmbänder in Schwingung.
Eine phonetischen Kategorie konstituiert sich, wie bereits gesagt, aus einer Klasse
von Lautsegmenten. Und über diese Zugehörigkeit zu Kategorien werden in der Phonetik
die Laute klassifiziert: ein Merkmal bei der Klassifikation eines Lautes, z.B. des
Lautes /b/, ist die Zugehörigkeit zu einer phonetischen Kategorie, also in diesem
Fall die Kategorie der stimmhaften Laute. Ein Merkmal
bei der Klassifikation des Lautes /p/ ist dessen Zugehörigkeit zur Kategorie der
STIMMLOSEN Laute. Dieser letzte Satz kann
auch negativ formuliert werden: Ein Merkmal bei der Klassifikation des Lautes /p/
ist, daß dieser nicht der Kategorie der stimmhaften
Laute angehört. Auf diese Weise haben wir nur ein einziges
Attribut, nämlich 'Stimmhaft', und zwei verschiedene Werte
für dieses Attribut, nämlich positiv (+) und negativ (-).
Definition 1.5. phonetisches Merkmal
Die Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit eines Lautsegments zu einer phonetischen
Kategorie ist ein phonetisches Merkmal dieses Segmentes. Phonetische Merkmale werden
in Form von Attribut-Wert-Paaren notiert, wobei der Attributname der Kategorie entspricht.
In dieser Definition taucht der Begriff Attribut-Wert-Paar
auf, der kurz erklärt werden soll. Attribut-Wert-Paare sind eine in der Linguistik
häufig verwendete Notationsform für die Merkmale von linguistischer Einheiten. Ein
kleines Beispiel aus einem ganz anderen Bereich der Linguistik wird diese Notationskonvention
begreiflich machen:
Für die Deklination englischer Personalpronomina (I, she, it, yours, our
usw.) sind die sekundären grammatischen Kategorien Person,
Numerus, Genus und
Kasus relevant. Das Pronomen her beispielsweise hat folgende
Flexionsmerkmale: 3. Person Singular Feminin Objective (=Objektskasus). Hier kann
auch gesagt werden: das Pronomen her hat für das Attribut 'Person' den
Wert '3.', für das Attribut 'Numerus' den Wert 'Singular', für das Attribut 'Genus'
den Wert 'Feminin' und für das Attribut 'Kasus' den Wert 'Objective'. Als Merkmalsmatrix
dargestellt sehen diese Attribut-Wert-Paare so aus:
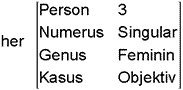
Dabei hat jedes dieser Attribute einen bestimmten Wertebereich.
Das Attribut 'Person' hat den Wertebereich 1. Person, 2. Person und 3. Person. Das
Attribut 'Numerus' hat den Wertebereich Singular und Plural. Das Attribut 'Genus'
hat den Wertebereich Feminin, Maskulin und Neutrum usw. Die Attribute und Wertebereiche
in diesem Beispiel sind so angelegt, daß sie (potentiell oder tatsächlich) mehr
als nur zwei Werte umfassen. Es gibt aber auch Attribute, die auf dem Prinzip der
Binarität aufgebaut sind, d.h. daß die Attribute jeweils entweder den Wert positiv
(+) oder den Wert negativ (-) haben. Ein Beispiel dafür haben wir bereits kennengelernt:
Das Attribut 'Stimmhaft' hat die beiden Werte + und -. Attribut-Wert-Paare werden
in eckigen Klammern notiert; bei binären Attributen steht der Wert vor dem Attribut:
/b/ [+ stimmhaft].
Eine phonetische Klassifizierung des Lautes /p/ würde u.a.beinhalten, daß dieser
stimmlos ist und zur Kategorie der aspirierten Laute gehört:
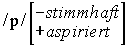
Vielleicht kann man schon sehen, wo das hinführt: Sprachlaute werden als Menge von
Attribut-Wert-Paaren repräsentiert, d.h. daß die Klassifikation eines Sprachlautes
über die Summe der phonetischen Merkmale dieses Lautes vollzogen wird.
Diese eher theoretischen Ausführungen über Segmente, phonetische Kategorien und
phonetische Merkmale erzeugt u.U. milde Verwirrung, darum sollen die Kerngedanken
kurz zusammengefaßt werden:
Lautkontinua werden mit Bezug auf die Extremposition der Sprechwerkzeuge segmentiert,
also in Segmente zerlegt. Diese Segmente bilden dann auf
der Basis gemeinsamer Eigenschaften Klassen. Diese Klassen heißen
Phonetische Kategorien. Die Zugehörigkeit eines Lautsegmentes zu einer
solchen Kategorie ist ein Phonetisches Merkmal dieses
Segments. Die Menge aller phonetischen Merkmale eines Segmentes konstituiert die
phonetische Klassifikation dieses Segmentes. Phonetische Merkmale werden in Form
von Attribut-Wert-Paaren notiert.
Abschließend noch eine Anmerkung zu diesem Abschnitt, für die wir die folgenden
Aussagen betrachten:
- Der Laut /b/ hat die Eigenschaft, stimmhaft zu sein.
- Der Laut /b/ gehört zur phonetischen Kategorie der stimmhaften Laute.
Bei der Beschreibung eines individuellen Lautes, hier also dem /b/, spielt es qualitativ
keine Rolle, ob man nun die erste oder die zweite Formulierung wählt. Der Sinn der
Klassenbildung wird immer dann ersichtlich, wenn man Aussagen macht, die sich eben
nicht auf individuelle Laute, sondern auf ganze Kategorien beziehen. (Segmentierung
und Klassifikation sind, nicht nur in diesem Bereich, zentrale Termini in der Linguistik.)
Um diesen Punkt zu veranschaulichen, ziehen wir ein Beispiel aus der deutschen Sprache
heran:
|
Tage
|
-
|
Tag
|
|
Liebe
|
-
|
lieb
|
|
baden
|
-
|
Bad
|
Es läßt sich bei der Aussprache dieser Wortpaare feststellen, daß der im Inlaut
des ersten Wortes stehende stimmhafte Konsonant diese Stimmhaftigkeit verliert,
wenn er am Wortende steht. Wir haben also folgenden Gegensatz:
|
Inlaut:
|
Auslaut:
|
|
Tage: /g/
|
Tag: /k/
|
|
Liebe: /b/
|
lieb: /p/
|
|
baden: /d/
|
Bad: /t/
|
Diese Erscheinung, auch Auslautverhärtung genannt, trifft
aber nicht nur auf die individuellen Laute /g/, /b/ und /d/ in den individuellen
Wörtern Tage, Liebe und Baden zu. Es betrifft vielmehr
alle Laute, die zur Kategorie der stimmhaften Verschluß- und Reibelaute
gehören, und zwar bei allen Wörtern, bei denen diese Laute im Auslaut
vorkommen können. Es ist die Bildung von phonetischen Kategorien, die es ermöglicht,
solche Gesetzmäßigkeiten in einem Satz auszudrücken. Es müssen nicht alle Einzelfälle
aufgezählt werden, um ein Phänomen erschöpfend zu beschreiben; sondern es werden
Aussagen über Klassen gemacht.
1.9 Prozesse der Lautproduktion
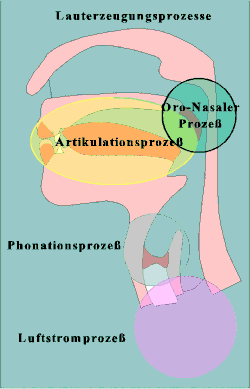
|
|
Abb. 1.9. Lautbildungsprozesse |
In den folgenden Kapiteln soll schrittweise herausgearbeitet werden, welche verschiedenen
phonetischen Kategorien es gibt. Damit ergibt sich gleichermaßen die phonetische
Klassifikation von Sprachlauten. Da wir uns an die artikulatorische Phonetik halten,
läuft die Ermittlung der phonetischen Kategorien über die Beschreibung der Lautproduktion
der jeweiligen Laute. Im Ansatz haben wir das bereits bei den Lauten /b/, /d/, /g/
usw. gesehen, die allesamt die phonetische Kategorie der stimmhaften Laute bilden.
Natürlich passiert bei der Lautproduktion mehr, als das nur die Stimmbänder schwingen
(oder eben nicht). Die einzelnen Prozesse bilden die Schwerpunkte der folgenden
vier Kapitel, wobei einem jeden dieser Teilprozesse ein Kapitel gewidmet ist.
In der artikulatorischen Phonetik wird die Lautproduktion in vier Teilprozesse eingeteilt.
(Diese vier Teilprozesse gehören allesamt in die organische und die aerodynamische
Phase der Phases of Speech.) Das heißt, daß jeder einzelne Laut als ein
Produkt des Zusammenspiels dieser vier Prozesse betrachtet wird. Im einzelnen handelt
es sich dabei um
- den Luftstromprozeß, durch den überhaupt erst die Erzeugung von Lauten ermöglicht
wird, da er quasi die Energiequelle eines Lautes, nämlich einen Luftstrom, liefert;
- den Phonationsprozeß, der sich auf die unterschiedliche Stellungen oder öffnungsgrade
der Stimmritze (= Glottis) bezieht, und in dem sich u.a. entscheidet, ob ein Laut
stimmhaft ist oder nicht;
- den oro-nasalen Prozeß, der sich auf die unterschiedlichen Stellungen des Gaumensegels
(= Velum) bezieht, und in dem sich entscheidet, ob ein Laut nasal bzw. nasaliert
ist oder nicht;
- den Artikulationsprozeß, der sich auf die unterschiedlichen Stellungen der Artikulationsorgane
bezieht, und in welchem der Luftstrom durch die Bewegung von Zunge und Lippen auf
unterschiedliche Arten modifiziert wird.
Wird diese Einteilung auf einen Laut angewendet, wird also ermittelt, welcher Art
der Luftstromprozeß ist, ob der Laut stimmhaft oder nicht ist, wie die Stellung
des Velums ist und also ob der Laut nasal ist oder nicht, und welche Artikulationsorgane
in den Lautbildungsprozeß involviert sind, so gelangt man zu einer umfassenden Klassifikation
eines Lautes.
Literatur.
|
Catford, J . C .
|
|
1977 |
Fundamental Problems in Phonetics. Edinburgh University Press: Edinburgh
|
|
1988 |
A Practical Introduction to Phonetics. Clarendon Press: Oxford
|
|
Crystal, David |
|
1975 |
The English Tone of Voice. Edward Arnold: London
|
|
1980 |
A Dictionary of Linguistics and Phonetics. André Deutsch |
|
Laver, John
|
|
1980 |
The Phonetic Description of Voice Quality. Cambridge University Press:
Cambridge
|
|
Sweet, Henry |
|
1877 |
Handbook of Phonetics. Clarendon Press: Oxford
|