2 Sprechwerkzeuge und Terminologie
2.0 Einleitung
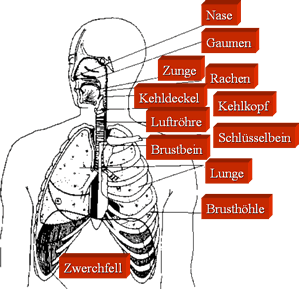
Abb. 2.1. Anordnung der Sprechwerkzeuge
(Auf das Bild klicken zum Abspielen einer Authorware-Sequenz)
In der Einleitung war des öfteren die Rede von den Sprechwerkzeugen oder
Sprechorganen, und es ist ausgesagt worden, daß die Beschreibung und Klassifikation
von Sprachlauten in der artikulatorischen Phonetik über die unterschiedlichen Stellungen,
Positionen, Bewegungen dieser Sprechorgane vollzogen wird. Mit Sprechwerkzeug
oder Sprechorgan sind all diejenigen Teile des Körpers gemeint, die unmittelbar
aktiv oder passiv in die Lautproduktion einbezogen sind. Dazu gehören u.a. die Lunge,
der Kehlkopf, der Gaumen, die Zunge, die Zähne, die Lippen etc. Eine besonders herausragende
Rolle spielt dabei die Zunge, die ein sehr flexibles Organ ist und es insbesondere
ermöglicht, die Resonanzeigenschaften des Mundraumes in vielfältiger Weise zu verändern.
Diese besondere Rolle ist auch daran erkennbar, daß in vielen Sprachen das Wort
für Zunge stellvertretend für Sprache insgesamt verwendet wird, z.B. lat. lingua
(span. lengua, frz. langue, it. lingua etc.), engl. tongue
(z.B. mother tongue), dt. Zunge (z.B. "Sie sprachen mit vielen Zungen").
Bei der Betrachtung der Sprechwerkzeuge sollte erwähnt werden, daß diese primär
nicht der Produktion von Lauten dienen, sondern andere Funktionen erfüllen: Die
Lunge etwa ist für die Atmung zuständig, der Kehlkopf verhindert, daß beim Schlucken
etwas in die Luftröhre gerät, die Zunge liefert u.a. wichtige sensorische Information
über den Geschmack oder die Temperatur dessen, was in den Mund genommen wird, die
Zähne dienen dem Zerkleinern von Nahrung und so fort.
In diesem Kapitel sollen die Sprechwerkzeuge anhand von Graphiken und Bildern anschaulich
und detailliert vorgestellt und benannt werden. Es soll einen Eindruck in die betroffene
Anatomie geben, aber auch als Referenz und Nachschlagetext für die folgenden Kapitel
dienen. Von den lateinischen Bezeichnungen der Sprechwerkzeuge ist auch die internationale
phonetische Terminologie abgeleitet.
2.1 Die Sprechwerkzeuge
Die Abb. 2.1. zeigt eine grobe Zusammenstellung der bei der Lauterzeugung beteiligten
Sprechorgane. Für eine überblickshafte Erläuterung der Erzeugungsmechanismen ist
es vorteilhaft, zunächst von einem vereinfachten Funktionsmodell der Sprechwerkzeuge
auszugehen (Abb. 2.2.). Dabei wird von den meisten anatomischen Details abstrahiert,
um die Funktionsweise in den Vordergrund zu stellen.
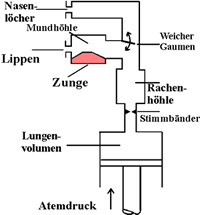
Abb. 2.2. Funktionsmodell des Vokaltraktes
Zur Erzeugung eines Schallereignisses gleich welcher Art ist eine Energiequelle
erforderlich. Im Falle der Spracherzeugung ist die Basis und Energiequelle eines
jeden Lautes ein Luftstrom, dessen Volumen und Druck die Dauer und Lautstärke des
Lautes bestimmen. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich dabei um einen Luftstrom,
der aus der Lunge kommt und den Körper über die Lippen verläßt.
Das menschliche Atmungssystem stellt also im Normalfall die Energiequelle für die
Schallerzeugung dar, wobei die Lungenflügel eine Art Luftreservoir darstellen. Durch
das Zusammenspiel der Lungenmuskulatur wird die Lunge zusammengedrückt, ähnlich
wie bei einem Blasebalg. Durch den entstehenden Druck wird die Luft nach außen gepreßt.
Auf seinem Weg von der Lunge zu den Lippen und gegebenenfalls zur Nase muß dieser
Luftstrom eine ganze Reihe von Stellen passieren, an denen er je nach Stellung der
betroffenen Organe modifiziert wird. Diese Veränderung des Luftstroms durch die
Sprechorgane ist verantwortlich für die Erzeugung der verschiedenen Sprachlaute.
Die Luft verläßt die Lunge durch die Luftröhre, fließt durch den Kehlkopf (Larynx), der eine Art Ventil darstellt, und gelangt so in
ein System von Höhlen, die als "Resonanzräume" wirken. Es handelt sich
um die Rachenhöhle (Pharynx), die Mundhöhle, und die Nasenhöhle.
Mund, Rachen und Nasenhöhle können durch verschiedene Stellungen des Gaumensegels
(Velum) sowie der Zunge miteinander in Verbindung treten.
Die Zunge ist ein sehr bewegliches Organ und kann den Luftstrom an verschiedenen
Stellen und auf verschiedene Weise kontrollieren. Nach außen steht das System durch
die Lippen als "Ventil" in Verbindung.
Bei der Charakterisierung einzelner Sprachlaute werden häufig schematisierte Darstellungen
der Sprechorgane wie in Abb. 2.4. verwendet. Dabei ist wichtig, sich einmal klar
zu machen, woraus diese Schemata abgeleitet sind.
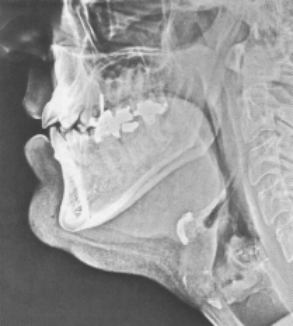
|
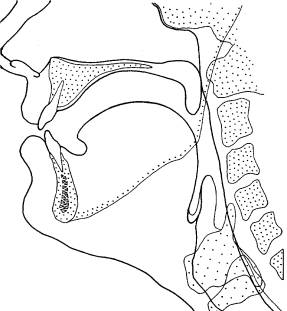
|
|
Abb. 2.3. Rögtenaufnahme der
Sprechorgane in neutraler Stellung
während der Aussprach des Vokals [ə]
|
Abb. 2.4. Neutrale Konfiguration des Lautgangs
auf der Basis der Röntgenaufnahme
|
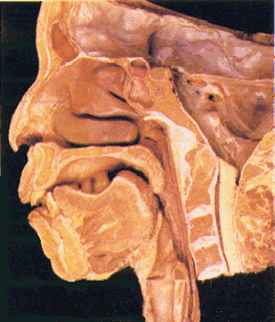 |
|
Abb. 2.5. Querschnitt durch den Schädel
|
Abb. 2.3. Zeigt eine Röngtenaufnahme der Sprechorgane bei der Bildung des unbetonten
Vokales [ə], der mit einer Konfiguration des Lautganges
erzeugt wird, die als relativ neutral betrachtet werden kann. Die schematische Darstellung
in Abb. 2.4. ist daraus durch Abstraktion abgeleitet, bei der nur die relevanten
Eigenschaften erhalten bleiben.
2.2 Die Resonanzräume
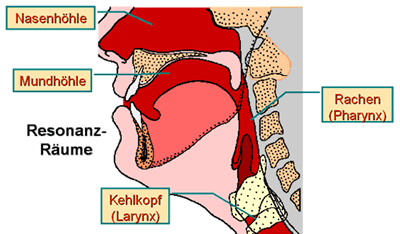
Abb. 2.6. Resonanzräume
Der Kehlkopf oder Larynx (Adj. laryngal) ist
ein durch Muskeln und Bänder verbundenes System von Knorpeln und wird im Kapitel
über Stimmbildung (Phonation) genauer beschrieben werden.
Er enthält ein Paar von elastischen Bändern, (Lippen oder Falten). Der Phonationsprozeß
umfaßt die Aktivität der Stimmlippen, sowie eines pyramidenförmigen Paares von Knorpeln,
Stellknorpel genannt, die mit den Stimmbändern verbunden
sind. Der Spalt zwischen den Stimmbändern und den Stellknorpeln wird
Stimmritze oder Glottis (Adj. glottal)
genannt. Die Glottis kann verschiedene Gestalten annehmen, d.h. die Stimmlippen
können mehrere verschiedene Positionen zueinander einnehmen. Darüber werden ebenfalls
bei der Phonation genauere Ausführung gemacht.
Oberhalb des Kehlkopfes schließt sich der Rachenraum oder
Pharynx (Adj. pharyngal) an. Das Volumen des Pharynx kann
auf verschiedene Weise verändert werden, z.B. durch Anhebung des Kehlkopfes, durch
ein Zurückziehen der Zungenwurzel, oder durch Kontraktion der Rachenrückenwand.
Oberhalb und vor der Rachenhöhle befinden sich zwei weitere Hohlräume, die Mundhöhle
und die Nasenhöhle. Der Boden des Mundes wird weitgehend durch die Zunge ausgefüllt,
die ihre Gestalt und ihr Volumen sehr flexibel verändern kann und in der Folge auch
die Resonanzeigenschaften des Mundraumes modifiziert. Vorne wird der Mund durch
die Zähne und Lippen begrenzt, an den Seiten durch die Wangen. Das Munddach besteht
aus den Oberzähnen, dem Zahndamm bzw. Alveolen
(unmittelbar hinter den Zähnen, Adj. alveolar), dem harten Gaumen (lat.
palatatum, daher das Adj. palatal) und dem weichen Gaumen, Gaumensegel
oder Velum (Adj. velar). Das Velum mündet in
das Zäpfchen, im Fachjargon Uvula (Adj. uvular)
genannt. Das Velum fungiert ebenfalls als Ventil. Es kann angehoben werden, sodaß
der Zugang zur Nasenhöhle versperrt ist, oder gesenkt, so daß Pharynx und Nasenhöhle
verbunden sind.
2.3 Terminologie
Die Artikulation von Lauten wird traditionellerweise unter Bezug auf die Organe
oder Organteile beschrieben, die direkt und unmittelbar an der Lauterzeugung beteiligt
sind. Diese wollen wir Artikulatoren nennen.
Definition 2.1. Artikulator
Artikulatoren sind Sprechorgane oder Teile von Sprechorganen,
die am unmittelbarsten an der Erzeugung eines bestimmten Lautes beteiligt sind.
Bei der Bildung des Anlautes im Wort pin kommt es beispielsweise entscheidend
darauf an, daß die Unter- und Oberlippe so aufeinandergepreßt werden, daß keine
Luft nach außen entweichen kann. Hier sind demnach die Unter- und Oberlippe die
Artikulatoren.
Die Rolle einiger Artikulatoren ist eher passiv, sei es daß sie unbeweglich sind,
sei es daß sie statisch verwendet werden. Die Oberzähne, der Zahndamm und der Gaumen
sind passive Artikulatoren. Die Unterlippe und verschiedene Teile der Zunge sind
aktive Artikulatoren.
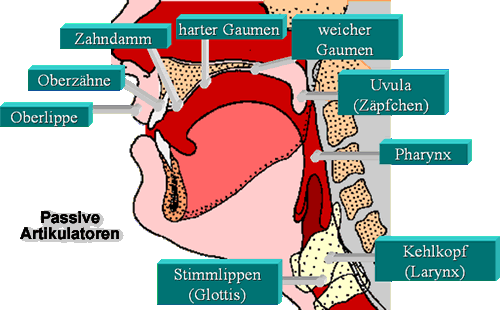
Abb. 2.7. Passive Artikulatoren
|
Passive Artikulatoren
|
|
Nr. |
Deutsch
|
Englisch
|
Latein
|
Adjektiv
|
|
1.
|
Lippe |
lip
|
labium |
labial |
|
2.
|
Zähne |
teeth
|
dentes
|
dental |
|
3.
|
Zahndamm |
teeth ridge
|
alveoli
|
alveolar |
|
|
|
|
|
postalveolar
a) retroflex
b) palato-alveolar |
|
4. |
harter Gaumen |
hard palate
|
palatum
|
palatal |
|
5. |
weicher Gaumen |
soft palate
|
velum
|
velar |
|
6. |
Uvula |
uvula
|
uvula
|
uvular |
|
7. |
Rachen |
pharynx
|
pharynx
|
pharyngal |
|
8. |
Kehlkopf |
larynx
|
larynx
|
laryngal |
|
|
Stimmritze |
glottis
|
glottis
|
glottal |
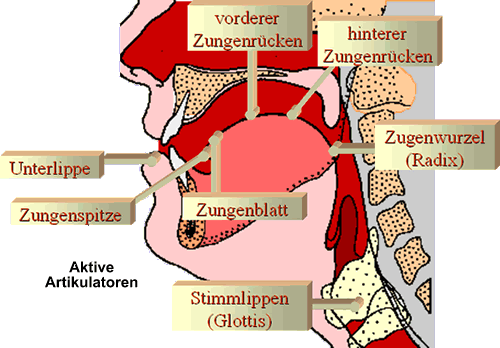
Abb. 2.8. Aktive Artikulatoren
|
Aktive Artikulatoren
|
|
Nr. |
Deutsch
|
Englisch
|
Latein
|
Adjektiv
|
Adj. in Komposita
|
|
|
Zunge |
tongue
|
lingua |
lingual |
(linguo-)
|
|
a |
Lippe |
lip
|
labium |
labial |
labio-
|
|
b |
Spitze |
tip
|
apex |
apikal |
apico-
|
|
c |
Blatt |
blade
|
lamina |
laminal |
lamino-
|
|
d |
vorder- |
front
|
|
prä- |
|
|
|
|
|
dorsum
|
dorsal
|
dorso-
|
|
e |
hinter- |
back
|
|
post- |
|
|
f |
Wurzel |
root
|
radix |
|
|