6 Der Artikulationsprozeß ‒ Artikulationsart
6.0 Einleitung
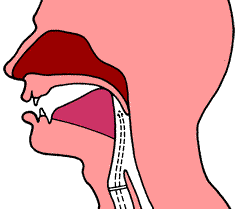
Abb. 6.1 Der Laut /k/
Der Artikulationsprozeß ist neben dem Luftstromprozeß die wichtigste Komponente
bei der Lauterzeugung. Der Luftstromprozeß ist die Basis eines Lautes, er liefert
quasi das Rohmaterial, aus dem ein Laut besteht: einen Luftstrom. Durch den Artikulationsprozeß
wird dieser Luftstrom moduliert und erhält die für den Laut typische Form.
Die Artikulation eines Lautes kann unter Bezug auf die Beziehung zwischen zwei Artikulatoren
(zu Artikulatoren siehe Kapitel 2) beschrieben werden, nämlich die Beziehung zwischen
einem passiven Artikulator und einem aktiven Artikulator. Zu den passiven Artikulatoren
gehören die Oberlippe, die Oberzähne, der Zahndamm, harter und weicher Gaumen, das
Velum und die Uvula. Die aktiven Artikulatoren sind die Unterlippe und die verschiedenen
Zonen der Zunge.
Bei der Lautklassifikation ist also zunächst einmal entscheidend, welche beiden
Artikulatoren überhaupt primär an der Artikulation des Lautes beteiligt sind. Wenn
dies feststeht, ist natürlich wichtig, auf welche Art und Weise sie den Luftstrom
modulieren. Dazu betrachtet man sich, wie eng die Artikulatoren bei der Artikulation
zusammentreffen.
Ein Beispiel soll dieses verdeutlichen; es geht um den Laut /k/ (vgl. Abb. 6.1):
- Artikulatoren: weicher Gaumen (passiv) und Hinterzunge (aktiv)
- Grad der Engebildung: völliger Verschluß
Im zweiten Punkt wird beschrieben, wie die Engstelle geartet ist, welche der Luftstrom
passieren muß, im ersten Punkt wird beschrieben, wo sich diese Engstelle im Lautgang
befindet. Auf genau diese Weise werden auch andere Laute beschrieben, es geht also
um
- Artikulationsort und
- Artikulationsart.
Ein weiteres Kriterium, welches aber unter Artikulationsart subsumiert wird, ist
der Zeitfaktor (s.u.). Wir wollen uns zunächst näher mit der Artikulationsart auseinandersetzen.
6.1. Artikulationsart
6.1.1. Grade der Engebildung
Je nach Annäherung der beiden Artikulatoren können verschiedene Engegrade unterschieden
werden. Diese Grade bilden eine Skala, welche von einem totalen Verschluß bis zu
einer maximalen Öffnung reicht. Diese beiden Positionen, totaler Verschluß und maximale
Öffnung, stellen die Endpunkte der ‘Engegrad–Skala’ dar. Ein Totalverschluß findet
sich bei Lauten wie /p/ oder /t/ oder /k/, die dementsprechend Verschlußlaute genannt
werden. Eine maximale Öffnung liegt bei einem Vokal wie /a/ vor. Dazwischen allerdings
gibt es noch verschiedene andere Grade und Arten der Engebildung. Traditionell werden
die folgenden Lautklassen aus dem jeweiligen Engegrad hergeleitet, wobei am Anfang
die Verschlußlaute stehen, bei den nachstehenden Klassen der Engegrad sukzessive
größer wird, bis zum Schluß die Vokale mit maximaler Öffnung auftreten:
|
Plosivlaute |
/p t k b d g/ |
|
Affrikaten |
/tʃ dʒ/ |
|
Frikative |
/f v θ ð s z ʃ ʒ(h)/ |
|
Nasale |
/m n ŋ/ |
|
Liquide |
/l, r/ |
|
Gleitlaute (Halbvokale) |
/j w/ |
|
Vokale |
/i e ɛ æ ɑ ɔ o u/ |
In den nachstehenden Abschnitten werden diese verschiedenen Grade erläutert und
es wird demonstriert, welche Auswirkungen sie auf den Luftstrom und also die Lautform
haben. Zum Einstieg betrachten und vergleichen wir zunächst die beiden Endpunkte
der Skala, totalen Verschluß und maximale Öffnung. Wir werden die Unterschiede zwischen
diesen beiden Lautklassen ermitteln und diese Unterschiede in Form einer Merkmalsmatrix
fixieren. Hernach werden wir diese Merkmalsmatrix schrittweise erweitern, einerseits
um Merkmale und (damit zusammenhängend) um weitere Lautklassen. Ziel des ganzen
ist es, die o.a. Lautklassen in einer Merkmalstabelle zu notieren, und die Merkmale
und somit die Lautklassen auf dem Weg dahin zu erläutern.
Verschlußlaute und Vokale unterscheiden sich von einander in vier Attributen.
- 1. Sonorant.
Vokale sind "von Natur aus" stimmhaft, d.h. im Normalfall werden die Stimmfalten
schwingen. Im Mundraum befindet sich kein Hindernis, so daß der Luftstrom ungehindert
entweichen kann. Dadurch erhalten Vokale maximale Schallfülle. Wir bezeichnen das
Schallfülleattribut mit dem Namen sonorant, so daß Vokale mit dem Merkmal [+sonorant]
Plosive (orale Verschlußlaute) hingegen mit dem Merkmal [−sonorant] gekennzeichnet
werden können.
- 2. Silbisch.
Als Folge der großen Schallfülle bilden Vokale ganz natürlich den Gipfel ihrer Silbe,
d.h. sie heben sich von den vorhergehenden und nachfolgenden Segmenten derselben
Silbe ab. Plosive hingegen, können nie als Silbengipfel vorkommen. Wir erfassen
diesen Unterschied mit dem Merkmal silbisch, das für Vokale positiv ([+silbisch])
für Plosive hingegen negativ ([−silbisch]) spezifiziert ist.
- 3. Okklusiv (verschlossen).
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß Vokale mit einem ungehinderten kontinuierlich
durch den Mund fließenden Lufstrom gebildet werden. Bei Plosivlauten hingegen, wird
ein orales Hindernis aufgebaut, das so beschaffen ist, daß der Luftstrom am Entweichen
gehindert wird. Wir kennzeichnen daher Plosive mit dem Merkmal [+verschlossen],
Vokale hingegen mit dem Merkmal [−verschlossen].
- 4. Konsonantisch.
-
Bei der Artikulation eines Verschlußlautes bildet entweder die Unterlippe oder ein
Teil der Zunge einen Kontakt mit einem passiven Artikulator. Bei der Artikulation
eines Vokals hingegen besteht kein solcher Kontakt. Dieser Unterschied kann durch
das Attribut konsonantisch erfaßt werden. Wenn wie bei Verschlußlauten der orale
Atemstrom durch ein Hindernis in seinem Fluß beeinträchtigt wird, haben die entsprechenden
Segmente das Merkmal [+okklusiv]. Vokale hingegen sind [−konsonantisch].
Diese Beschreibung der "klaren Fälle", d.h. Verschlußlaute (oder enger
Plosive) und Vokale, kann wie folgt tabellarisch zusammengefaßt werden:
|
|
silbisch
|
sonorant
|
okklusiv
|
konsonantisch
|
|
Plosive
|
−
|
−
|
+
|
+
|
|
Vokale
|
+
|
+
|
−
|
−
|
Tab. 6.1. Plosive vs. Vokale
Die anderen vier Lautklassen, Nasale, Frikative, Liquide, und Gleitlaute (oder Halb-Vokale),
teilen sich Eigenschaften teils mit den Plosiven, teils mit den Vokalen, haben darüber
hinaus natürlich auch Attribute durch die sie sich von diesen und untereinander
unterscheiden. Es ist das Ziel der folgenden Ausführungen, diese Unterschiede und
Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten
6.1.2. Totalverschluß: Plosive und Nasale
Beginnen wir mit einer etwas ausführlicheren Besprechung der Verschlußlaute.
Definition 6.1. Verschlußlaut (Okklusiv)
Laute, die mit einem Totalverschluß zweier Artikulatoren im Lautgang gebildet werden,
heißen Verschlußlaute (Okklusive, engl. stop).
Definition 6.2. Dauerlaut
Alle Laute, die nicht Verschlußlaute sind, sind Dauerlaute (engl. continuant).
Aus diesen Definitionen folgt, daß Verschlußlaute und Dauerlaute komplementär sind,
so daß die einen auf der Basis der anderen definiert werden können. Abweichend von
der üblichen Praxis, werden wir die Verschlußlaute zugrunde legen. Verschlußlaute
werden damit durch das Merkmal [+okklusiv] gekennzeichnet, Dauerlaute durch das
Merkmal [−okklusiv].
Alle Verschlußlaute im oben definierten Sinne gehören also zur Kategorie [+okklusiv]
alle anderen zur Kategorie [-okklusiv]. Beispiele:
[+okklusiv]: /p b m pf t d n ts tʃ dʒ k g ŋ ʔ/
(z.B. Park, Barke, Marke,
Pfad, Tag, Dose, Nase,
Zahn, Kahn, Gans, Tang,
Aas [ʔaːs], engl. chin [tʃɪn],
gin [dʒɪn])
[−okklusiv]: /f v s z ʃ (ʒ) [ç, x] h j w l r (Vokale)/
(z.B. fahren, Waren, reißen,
reisen, Schiff, Rouge, ich
[ɪç], ach [ax],
Hut, Jahr, Lappe, Rappe,
engl. pressure, pleasure,
wet)
Je nach Art der Verschlußlösung und der Beteiligung nasaler Resonanz können wir
verschiedene Unterklassen der Verschlußlaute unterscheiden: nasale Verschlußlaute,
orale Verschlußlaute mit abrupter Lösung (Plosive), orale Verschlußlaute mit verzögerter
Lösung (Affrikaten).
Man beachte, daß dieser Verschlußlaut-Dauerlaut-Parameter unabhängig von den Stellungsmöglichkeiten
des Velums definiert ist. Dieses kann entweder gehoben oder gesenkt sein. Mit anderen
Worten, die Merkmale [± okklusiv] und [± nasal] sind frei kombinierbar. Theoretisch
ergeben sich daraus folgende Merkmalsmatrizen:
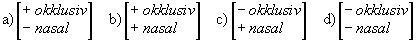
Die Matrizen a) and b) repräsentieren orale bzw. nasale Verschlußlaute.
Definition 6.3. Plosiv
Orale Verschlußlaute mit abrupter Verschlußlösung heißen Plosive.
 :
/p, b, t, d, k, g, (ʔ)/
:
/p, b, t, d, k, g, (ʔ)/
Beispiele: pin, bin, tin,
din, call, gall, Cockney
butter [bʌʔə]
Definition 6.4. Nasal
Nasale Verschlußlaute heißen Nasale.
 :
/m n ŋ/
:
/m n ŋ/
Beispiele: Wamme, Wanne, Wange
Das Vorhandensein nasaler Resonanz bei Segmenten mit dem Merkmal [–okklusiv] (d.h.
bei Lauten mit dem Merkmalskomplex [–okklusiv, +nasal]) wird Nasalierung genannt.
Nasalierung ist nur bei Vokalen gebräuchlich.
Das Merkmal [± nasal] unterteilt die Verschlußlaute in Plosive und Nasale. Nasalität
ist jedoch nicht das einzige Attribut, das Nasale von Plosiven unterscheidet. Nasale
sind quasi "musikalisch", d.h. man kann mit ihnen singen. Es handelt sich
also um ein Attribut, das Nasale mit den Vokalen gemeinsam haben, und das wir oben
mit dem Merkmal [+sonorant] gekennzeichnet haben.
Obwohl Nasalkonsonanten normalerweise unsilbisch sind, d.h. keinen Silbengipfel
bilden, können sie in bestimmten Kontexten silbisch werden. Dies ergibt sich aus
ihrer relativ hohen Schallfülle. Im Englischen, z.B., werden Nasalkonsonanten in
unbetonten Endsilben silbisch: written, mitten. In der phonetischen Umschrift
können silbische Varianten durch einen kleinen senkrechten Strich unterhalb des
fraglichen Segments angezeigt werden, z.B. [mɪtn̩, sɛvn̩]].
Wir können also Nasale als wahlweise silbisch klassifizieren, je nach Kontext.
|
|
silbisch
|
sonorant
|
konsonantisch
|
okklusiv
|
nasal
|
|
Plosiv
|
–
|
–
|
+
|
+
|
–
|
|
Nasal
|
±
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Vokal
|
+
|
+
|
–
|
–
|
±
|
Tab. 6.2.
In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Arten der Verengung zwischen zwei
Artikulatoren schematisch dargestellt. Der passive (obere) Artikulator wird durch
eine gerade Linie repräsentiert werden. Eine zweite Linie zeigt – von links nach
rechts – den Bewegungsablauf eines aktiven Artikulators als Annäherung an bzw. Entfernung
von dem passiven Artikulator. Der Abstand zwischen den Artikulatoren zeigt mithin
den Öffnungsgrad an. Betrachten wir die Lautfolge [apha]
(beispielsweise in dem Wort Papa). Bei der Artikulation des [a]
sind die Artikulatoren weit auseinander. Beim Übergang zum [ph]
schließt sich der Unterkiefer und die Unterlippe bewegt sich auf die Oberlippe zu.
Diese Phase der Verschlußbildung wird Anglitt genannt. Es folgt darauf die Haltephase
oder Okklusion, die über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten werden kann.
Manche Sprachen unterscheiden zwischen kurzen und langen Konsonanten. Im Falle der
Verschlußlaute liegt der Unterschied in der verschieden langen Haltephase.
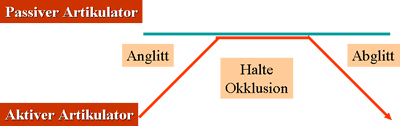
Abb. 6.2.
Wir halten fest: Bei der Bildung einer Verschlußartikulation können wir drei Phasen
unterscheiden:
- Die Bewegung des aktiven Artikulators in eine Verschlußstellung wird Anglitt genannt
(engl. onset oder onglide).
- Die Verschlußphase selbst heißt Halte (engl. hold) oder Okklusion (engl. occlusion).
- Die Bewegung von der Verschlußstellung weg heißt Abglitt (engl. offglide) oder Lösung
(engl. release).
Die Untscheidung dieser Phasen kann wichtig werden durch die Art und Weise wie sie
mit anderen phonetischen Prozessen interagieren. Wenn beispielsweise während der
Phase der Verschlußlösung eines stimmlosen Plosivs wie dem /p/ in pin der
Stimmeinsatz des Vokals mit Verzögerung beginnt, erhalten wir eine Übergangsphase,
die man Aspiration nennt: [pʰɪn]. Andere Abglittphänomene
werden weiter unten behandelt
6.1.3 Engelaute: Frikative und Affrikaten
Das wichtigste Kriterium für die Segmentierung des Kontinuums der Grade der Verengung
ist die An- oder Abwesenheit von Turbulenz im Luftstrom hinter der Verengung. Ein
turbulenter Luftstrom hat eine ‘zischende’ Qualität. Da die Ausprägung der Turbulenz
von der Energiemenge des Luftstroms abhängt und die Vibration der Stimmbänder einen
Teil dieser Energie absorbiert, ist auch die Stimmtonbeteiligung ein wichtiger Faktor.
Laute wie /f/ und /v/ werden durch eine sehr starke Annäherung zwischen zwei Artikulatoren
gebildet (Unterlippe und Oberzähne). Wenn ein Luftstrom durch diese Enge wie durch
eine Düse gezwängt wird, entsteht hinter der Verengung eine Turbulenz, unabhängig
davon ob die Stimmbänder schwingen oder nicht.
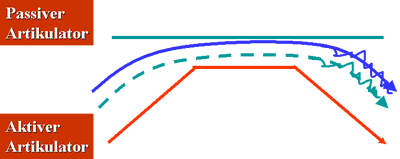
Abb. 6.3. Frikativ
Die durchgezogene Linie zeigt einen Luftstrom ohne Vibration der Stimmbänder, die
gestrichelte Linie einen solchen mit Vibration. Es ist erkennbar, daß der Grad der
Turbulenz bei stimmlosen Lauten größer ist.
Definition 6.5. Frikativ
Laute, die sowohl ohne als auch mit Stimmtonbeteiligung einen turbulenten Luftstrom
aufweisen heißen Frikative (Reibelaute) (lat. fricare ‘reiben’) .
Im Rahmen des bis jetzt entwickelten Merkmalsystems können Frikative durch die Merkmale
[−okklusiv, −sonorant,−nasal] charakterisiert werden.
|
|
silbisch
|
sonorant
|
konsonantisch
|
okklusiv
|
nasal
|
|
Plosiv
|
−
|
−
|
+
|
+
|
−
|
|
Frikativ
|
−
|
−
|
+
|
−
|
−
|
|
Nasal
|
±
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Vokal
|
+
|
+
|
−
|
−
|
±
|
Tab. 6.3.
Reibelaute:
 :
/f v θ ð s z ʃ ʒ [x ç] h/
:
/f v θ ð s z ʃ ʒ [x ç] h/
Beispiele: finden, winden,—, —, reißen,
reisen, Schal, (Rouge), ja,
ich, ach, Hut.
Beispiele: fat, vat, thick,
this, soul, zone,
fission, vision, ship, measure,
—, —, hose.
Segmente wie /pf ts/ im Deutschen oder /tʃ
dʒ/ sind sowohl Verschlußlaute, als auch als Frikative. Man nennt solche
Laute Affrikaten. Sie entstehen dadurch, daß die Lösung des Verschlusses nicht abrupt
erfolgt sondern mit Verzögerung, so daß eine längere Phase entsteht, in der die
Artikulatoren so angenähert sind, daß sich eine für Reibelaute typische Verengung
bildet, durch welche die Luft entweichen kann, wobei hinter der Verengung Turbulenzen
erzeugt werden.
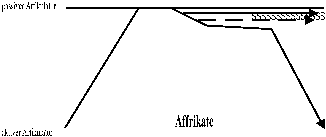
Abb. 6.4. Affrikate
Definition 6.6. Affrikate
Affrikaten sind Verschlußlaute mit verzögerter Verschlußlösung, so daß ein turbulenter
Luftstrom erzeugt wird.
Beispiele: engl. /tʃ dʒ/: chin,
gin, batch, badge
deutsch /pf ts/: Pfahl
(vs. fahl), Katze (vs.
Kasse)
Unter phonologischen Gesichtspunkten (im Gegensatz zu phonetisch) können Affrikaten
entweder als phonematische Einheiten behandelt werden, die an paradigmatischen Oppositionen
wie tip:chip, ship:chip etc. teilhaben, oder als Phonemsequenzen wie /t+ʃ/ oder /d+ʒ/. Welche Analyse vorzuziehen
ist hängt u.a. von der phonologischen Gesamtstruktur der betroffenen Sprachen ab,
insbesondere von ihrer syntagmatischen Struktur. Im Englischen z.B. wäre es unklug
die Affrikaten /tʃ,dʒ/ im Silbenanlaut als Phonemsequenzen
zu betrachten. Abgesehen von /sp st sk/, die einen Sonderstatus haben, sind im Englischen
Anlautkombinationen aus zwei Obstruenten (Konsonanten mit dem Merkmal [–sonorant])
nicht möglich. Die Analyse der englischen Affrikaten als Phonemfolgen /t+ʃ/
oder /d+ʒ/ (mithin als Sequenzen von [–sonorant][–sonorant])
würde diesem allgmeinen Strukurprinzip widersprechen. Außerdem sind die Affrikaten
historisch gesehen jedenfalls zum Teil aus palatalen Plosivlauten entstanden (in
anderen Fällen durch Entlehung aus dem Französichen).
Umgekehrt sind im Deutschen die Affrikaten /pf/ bzw. /ts/ aus /p/ bzw. /t/ entstanden
(so noch heute im Niederdeutschen) und können wie Plosive Anlautverbindungen mit
den Liquiden /l, r/ eingehen (z.B.: Pflug, Pfriem).
Wenn Affrikaten nicht als Sequenzen aufgefaßt werden, benötigen wir ein Attribut,
das Affrikaten von Plosiven unterscheidet. Phonetisch betrachtet ist für die Affrikaten
die verzögerte Verschlußlösung konstitutiv. Chomsky & Halle (1968) haben dafür
die Bezeichnung delayed release vorgeschlagen. Ich schlage
dafür die transparentere Bezeichnung affrikativvor. Affrikaten
haben dann das Merkmal [+affrikativ], Plosive das Merkmal [–affrikativ].
|
|
silbisch
|
sonorant
|
konsonantisch
|
verschlossen
|
nasal
|
affrikativ
|
|
Plosiv
|
–
|
–
|
+
|
+
|
–
|
–
|
|
Affrikate
|
–
|
–
|
+
|
+
|
–
|
+
|
|
Frikativ
|
– |
–
|
+
|
–
|
–
|
|
|
Nasal
|
±
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
Vokal
|
+
|
+
|
–
|
–
|
±
|
|
Tab. 6.4.
Plosive, Affrikaten, und frikative können zur Klasse der Obstruenten zusammengefaßt
werden.
Definition 6.7. Obstruent
Mit dem Terminus Obstruent werden Laute bezeichnet, die mit einer Verengung gebildet
werden, die den Luftstrom durch die Nase oder den Mund behindert.
Alle Nicht-Obstruenten sind Sonoranten.
Definition 6.8. Sonorant
Sonoranten sind Laute, die mit einem relativ ungehinderten Luftstrom gebildet werden,
bei dem die Stimmfalten so angeordnet sind, daß spontane Stimmbildung möglich ist,
wie bei Vokalen, Liquiden, Nasalen, und Lateralen.
6.1.4 Approximanten: Liquide
Von den eingangs aufgelisteten Oberklassen haben wir bisher die Liquide und Gleitlaute
noch nicht näher bestimmt.
Wenn man die Unterlippe während der Artikulation von /v/ nach unten bewegt, so daß
die labiale Öffnung immer größer wird, kommt man bald an eine Stellung, bei der
das Reibegeräusch des stimmhaften Frikativs verschwindet. Wenn man dann diese Stellung
beibehält aber die Glottis öffnet, erhöht sich Geschwindigkeit des Luftstroms insgesamt
und die Strömung durch die labio-dentale Öffnung wird erneut turbulent. Wir haben
also einen Verengungsgrad, der bei Stimmlosigkeit ein Reibegeräusch erzeugt, bei
Stimmhaftigkeit jedoch nicht. Laute mit dieser Eigenschaften heißen Approximanten.
Definition 5.9. Approximant
Approximanten sind Laute mit einer Annäherung zweier Artikulatoren, die so beschaffen
ist, daß nur bei Stimmlosigkeit Luftverwirbelungen entstehen.
Zu den Approximanten gehören im Englischen und Deutschen die Liquide /l/ und /r/
(in lead und read bzw lasen und rasen. Bei der
Artikulation dieser Laute ist die Zunge gegenüber der neutralen Stellung angehoben,
so daß sie für den Luftstrom ein partielles Hindernis darstellt. Liquide haben also
u.a. das Merkmal [+konsonantisch]. Der Zungenkörper ist jedoch so geformt, daß die
Luft ihn umfließen kann. Dies geschieht entweder an den Zungenrändern (im Falle
von /l/) oder in Zungenmitte. Liquide haben mit Nasalen das Merkmal [+sonorant]
gemeinsam. Sie unterscheiden sich von ihnen außer durch die Nasalierung darin, daß
letztere Verschlußlaute sind [+okklusiv]. Wie die Nasale sind Liquide prototypisch
unsilbisch [–silbisch], können jedoch in bestimmten Kontexten den Silbengipfel bilden,
z.B. in metal [mɛtl̩]. Eine unterschiedliche morphologische
Struktur kann sich hier phonologisch auswirken, wie der Kontrast zwischen codling
(cod+ling) und coddling (coddle + ing), [kɔdlɪŋ] vs. [kɔdl̩ɪŋ] zeigt.
|
|
silbisch
|
sonorant
|
konsonantisch
|
okklusiv
|
nasal
|
affrikativ
|
|
Plosiv
|
−
|
−
|
+
|
+
|
−
|
−
|
|
Affrikate
|
−
|
− |
+
|
+
|
−
|
+
|
|
Frikativ
|
− |
−
|
+
|
−
|
−
|
|
|
Nasal
|
±
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
Liquid
|
±
|
+
|
+
|
−
|
−
|
|
|
Vokal
|
+
|
+
|
−
|
−
|
±
|
|
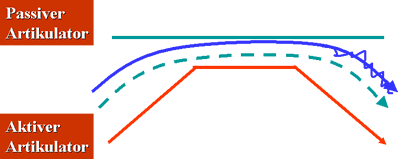
Abb.6.5.
6.1.5 Resonant: Gleitlaute und Vokale
Wenn die Öffnung zwischen den Artikulatoren noch größer wird, verschwinden die Luftverwirbelungen
auch bei Stimmlosigkeit. Laute, die unabhängig von der Stellung der Glottis nicht-turbulent
sind, heißen Resonanten. Typische Resonanten sind die eher offenen Vokale wie /e/
oder /o/.
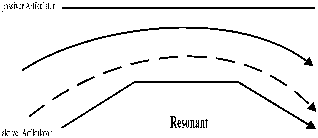
Abb. 6.6. Resonant
Definition 6.10. Resonant
Resonanten sind Laute, die mit einer Annäherung zweier Artikulatoren gebildet werden,
die auch bei Stimmlosigkeit keine Luftverwirbelung erzeugt.
|
|
silbisch
|
sonorant
|
konsonantisch
|
okklusiv
|
nasal
|
affrikativ
|
|
Plosiv
|
−
|
−
|
+
|
+
|
−
|
−
|
|
Affrikate
|
−
|
−
|
+
|
+
|
−
|
+
|
|
Frikativ
|
−
|
−
|
+
|
−
|
− |
|
|
nasal
|
±
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
Liquid
|
±
|
+
|
+
|
−
|
−
|
|
|
Gleitlaut
|
− |
+
|
−
|
−
|
−
|
|
|
Vokal
|
+
|
+
|
− |
−
|
±
|
|
Tab. 6.5.
Damit bleibt noch die Frage zu klären, was den Gleitlaute von Vokalen unterscheidet.
Zu den Gleitlauten gehören im Englischen das /j/ in yet und das /w/
in wet. Sie entsprechen in den meisten Eigenschaften den Vokalen /i/ und
/u/. Wie der Name schon andeutet, sind Gleitlaute im wesentlichen schnelle (ballistische)
Bewegungen auf eine Zielposition hin. Es ist nicht erforderlich, daß diese Zielposition
auch erreicht wird. Gleitlaute haben keine Dauer. Vokale hingegen sind "verlängerbar".
Daraus folgt auch, daß Gleitlaute nicht silbenbildend sein können. Die Fähigkeit
silbenbildend zu sein, ist in der Tat das essentielle Attribut, das Vokale von Gleitlauten
unterscheidet. Vokale haben daher das Merkmal [+silbisch], Gleitlaute das Merkmal
[−silbisch].
6.1.6 Vibrationslaute
Ein weiterer Typ von Verengungslauten wird durch die Vibranten (engl. trill)
gebildet. Dabei schlägt ein flexibles Organ wiederholt gegen ein anderes, wie in
dem gerollten apikalen /r/ des Italienischen, Spanischen und in verschiedenen deutschen
Dialekten; oder zwei flexible Organe schlagen gegeneinander, wie z.B. die Lippen
bei einem bilabialen Vibranten. Der Erzeugungsmechanismus ist der gleiche wie bei
der Vibration der Stimmfalten (Bernoullieffekt).
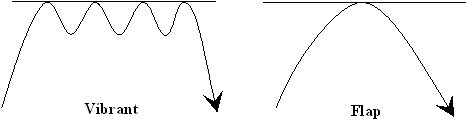
Abb. 6.7. Vibrant und Flap
Definition 6.11. Vibrant
Ein Vibrant ist ein Laut, bei dem ein flexibles Organ wiederholt gegen ein anderes
schlägt, oder zwei flexible Organe gegeneinander.
Definition 6.12. Flap
Ein Flap ist eine kurzzeitige ballistische Bewegung eines flexiblen Organs gegen
einen passiven Artikuklator.
Manche Sprecher des Britischen Englischen verwenden einen Flap für das /r/ in intervokalischer
Stellung in Wörtern wie very oder unmittelbar nach dem dentalen Frikativ
/θ/ in Wörtern wie three ([θɾiː]).
Viele Amerikaner ersetzen das intervokalische /t/ in Wörtern wie city durch
einen Flap: [sɪɾɪ].
6.1.7 Lateralität
Bei lingualen Lauten, d.h. solchen die mit der Zunge artikuliert werden, können
wir im Hinblick auf die ‘transversale’ Dimension zwei Möglichkeiten der Lokalisierung
der Verengung unterscheiden. Die Enge kann mit der Zungenmitte gebildet werden oder
an den Zungenrändern. Erstere Laute heißen zentral, letztere lateral (aus lateinisch
latus,-eris ‘Seite’).
Definition 6.13. Lateral
Ein Lateral ist ein Laut, dessen Verengung an einer oder an beiden Seiten der Zunge
gebildet wird.
Definition 6.14. central
Ein zentraler Laut ist ein Laut, der mit einer Verengung in der Zungenmitte hervorgebracht
wird.
Die Begriffe lateral und zentral sind wiederum komplementär. Die Kategorie zentral
kann als [–lateral] definiert werden. Im Englischen und Deutschen gibt es nur jeweils
ein laterales Phonem, nämlich /l/. Es ist ein Approximant und normalerweise stimmhaft.
In bestimmten Kontexten jedoch, z.B. nach stimmlosen Plosiven vor betonten Vokalen
kann das englische /l/ jedoch stimmlos und damit zum Reibelaut werden: [pl̥au],
[kl̥uː] plough, clue.
In manchen Sprachen kommen sowohl stimmlose als auch stimmhafte laterale Frikative
vor.
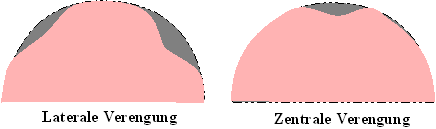
Fig. 6.8. Laterale vs. Zentrale Verengung
6.1.8. Sibilanten
Es besteht ein deutlicher akustischer Unterschied zwischen Frikativen wie /s/ und
/ʃ/ auf der einen Seite und /θ/
auf der anderen. Erstere weisen einen hohen Anteil an hochfrequenter akustischer
Energie auf, wodurch sie eine charakteristisch zischende Qualität erhalten. Laute
mit einer derartigen akustischen Struktur werden durch das auditive Merkmal sibilant
(aus lat. sibilare ‘zischen, pfeifen’) bezeichnet.
Definition 6.15. Sibilant
Sibilanten (Zischlaute) sind Frikative und Affrikaten. Diese weisen eine vergleichsweise
starke Konzentration akustischer Energie mit hohen Frequenzen auf.
Am einfachsten lassen sich diese Laute durch Aufzählung aussondern. Im Englischen
handelt es sich um die folgenden Segmente:
[+sibilant]: /s z ʃ ʒ t ʃ dʒ/
Beispiele: sip zip ship
pleasure chip gin
Diese Lautklasse spielt bei der Beschreibung der Pluralbildung im Englischen eine
wichtige Rolle. Die regelmäßige Pluralendung weist drei lautlich verschiedene Varianten
(Allomorphe) auf: /z/ wie in dogs, /s/ wie in cats, und /iz/ wie
in bridges. Die Verwendung dieser Allomorphe ist von der Beschaffenheit
des unmittelbar vorangehenden Segmentes abhängig. Die Form /z/ steht nach Segmenten
mit den Merkmalen [-sibilant, +stimmhaft], /s/ nach Segmenten mit den Merkmalen
[–sibilant, −stimmhaft], und /iz/ nach Segmenten mit
dem Merkmal [+sibilant]. Die gleiche Verteilung gilt für das Possessivsuffix in
John's, cat's, James's, und die unbetonte Form von is in John's
in the garden, the cat's in the garden vs. James is in the garden.
6.1.9 Länge
Mit Ausnahme der Flaps und Halbvokale, die notwendigerweise momentan sind, kann
die Haltephase aller Lauttypen beliebig verlängert werden. Verschlußlaute, Frikative,
Affrikaten und Resonanten sind verlängerbar. Im Italienischen gibt es einen systematischen
Kontrast zwischen kurzen und langen Konsonanten, wie in fato ‘Schicksal’
vs. fatto ‘gemacht’. Das Spanische unterscheidet zwischen einem lingualem
Flap und einem lingualen Vibranten wie in pero ‘aber’ vs. perro
‘Hund’. Im Englischen und Deutschen spielt das Attribut Länge eine Rolle bei der
Charakterisierung von Vokalartikulationen. Im internationalen phonetischen Alphabet
wird die Länge durch einen Punkt (halb-lang): /diˑp/, oder
einen Doppelpunkt (lang): /diːd/ repräsentiert.
6.1.10 Artikulationsstärke
Im Englischen wie im Deutschen wird die Opposition zwischen sogenannten stimmlosen
und stimmhaften Lauten nicht ausschließlich durch die An- oder Abwesenheit des Stimmtons
unterschieden. Vielmehr gibt es sogar Kontexte, in welchen die Opposition aufgehoben
ist. Englische Konsonanten, die normalerweise stimmhaft sind, tendieren dazu mit
relativ schwacher Energie artikuliert zu werden, während die immer stimmlosen Konsonanten
relativ stark sind, d.h. mit höherem subglottalen Druck und größerer Muskelanspannung
gesprochen werden. Traditionellerweise unterscheidet man zwischen (starker) Fortisartikulation
und (schwacher) Lenisartikulation.
Definition 6.16. Fortis
Fortiskonsonanten sind Laute, die mit ‘starker’ Artikulation, d.h. mit höherem subglottalen
Druck und größerer Muskelanspannung gebildet werden.
[+fortis]: /p f t θ s ʃ tʃ k h/
Beispiele: pit, fit, tin,
thick, sin, ship, chip,
kick, hit.
[–fortis]: /b v d ð n z ʒ dʒ g ŋ l r j w (Vokale)/
Beispiele: bit, vat, din,
this, net, zombie, azure,
judge, give, song,
lip, rob, yeast, well
Fortisartikulation korreliert mit Stimmlosigkeit und verschiedenen Graden der Aspiration.
Leniskonsonanten sind nicht aspiriert. Im Englischen korrelliert Lenisartikulation
mit größerer relativer Dauer des vorangehenden Segments. Die Vokale in bit
und bid sind, obwohl sie dem gleichen Typ [ɪ]
angehören, unterschiedliche lang: das /i/ in bid [bɪˑd]
ist merklich länger als das in bit. Das gilt auch für andere Sonoranten,
z.B.. killed vs. kilt, rend vs. rent, ride vs. write.
6.2 Verschlußlösungsphänomene
Wie bereits ausgeführt kann die Lösungsphase eines Plosivs in verschiedener Weise
mit anderen phonetischen Prozessen intgeragieren. Nicht immer werden Plosive durch
die Beseitigung des oralen Vertschlusses gelöst.
- Im Auslaut wie in map, mat, mack, oder robe, road, rogue, kann
die Okklusion aufrecht erhalten werden, während der Luftdruck reduziert und der
Verschluß durch ein langsames und relativ unhörbares Öffnen des oralen Verschlusses
gelöst wird. Diese unhörbare Lösung kann durch ein diakritisches Zeichen wiedergegeben
werden: [mæp̚, mæt̚, mæk̚, rəʊb ̚, rəʊd ̚, rəʊg ̚].
- In einer Aufeinanderfolge von zwei Plosiven erfährt der erste keine hörbare Lösung,
z.B. in dropped [drɒp ̚t], rubbed [rʌb̚d], white post, good boy, locked, big boy, object, big chin.
- Wenn auf einen Plosiv ein homorganer Nasalkonsonant folgt, wird die Luft nicht wie
üblich durch Beseitigung des oralen Verschlusses gelöst, sondern durch Senken des
Velums, so daß die Luft durch die Nasenhöhle entweichen kann, z.B. topmost, cotton,
sudden. Diese nasale Verschlußlösung kann durch ein hochgestelltes n
gekennzeichnet werden: [sʌdⁿ].
- Folgt auf die Plosive /t/ und /d/, ein /l/, erfolgt die Verschlußlösung normalerweise
lateral, d.h. auf einer oder beiden Seiten der Zunge: cattle, medal, atlas, regardless
etc. Obwohl die Situation bei Folgen aus /p b k g/ + /l/ etwas verschieden ist (beim
Übergang vom Verschluß zum Lateral wird auch der Artikulationsort gewechselt) sprechen
wir auch in Wörtern wie apple, bubble, tackle, eagle von lateraler Verschlußlösung
etc. In phonetischer Umschrift kann diese Art der Verschlußlösung durch ein hochgestelltes
l wiedergegeben werden: [rɪdˡ] (riddle).