4 Phonation
4.0 Einleitung
Der im Normalfall durch die Aktivität der Atmungsmuskulatur erzeugte Luftstrom,
sozusagen die "Trägerwelle" des Sprechens, wird auf dem Weg nach außen
durch eine Reihe verschiedener Prozesse "moduliert". Die erste Stelle,
an der eine derartige Modulation erfolgen kann, ist der Kehlkopf oder
Larynx (Adj. laryngal). Der larnygale Prozeß, um den es sich hier vorrangig
handelt, wird Phonation genannt.
Definition 4.1. Phonation
Unter Phonation versteht man jede laryngale Sprechtätigkeit, die weder der Erzeugung
eines Luftstroms noch der Artikulation dient, sondern vielmehr der Bildung einer
hörbaren akustischen Engergiequelle auf der Basis eines durch das Atmungssystem
bereitgestellten Luftstroms.
Die Vibration der Stimmlippen bei der Erzeugung des charakteristischen Stimmtons
von Vokalen wie [a e i o u]) oder Resonanten wie [m n l j w] ist eine laryngale
Aktivität, die ausschließlich eine phonatorische, d.h. stimmbildende Funktion hat.
Im Gegensatz dazu ist der vollständige Verschluß zwischen den Stimmlippen bei der
Bildung des sog. Kehlkopf- oder Glottisverschlußlautes [ʔ],
der z.B. im Deutschen im Anlaut aller Wörter gesprochen wird, die orthographisch
mit Vokal beginnen (z.B. Ei [ʔaɪ] oder Akt
[ʔakt]), eine laryngale Aktivität mit artikulatorischer
Funktion. Die Auf- oder Abwärtsbewegung des Kehlkopfes bei der Produktion glottalischer
Laute (Ejektive oder Implosive), die wir im vorangegangen Kapitel kennengelernt
haben, ist eine laryngale Aktivität, die der Bildung eines Luftstromes dient.
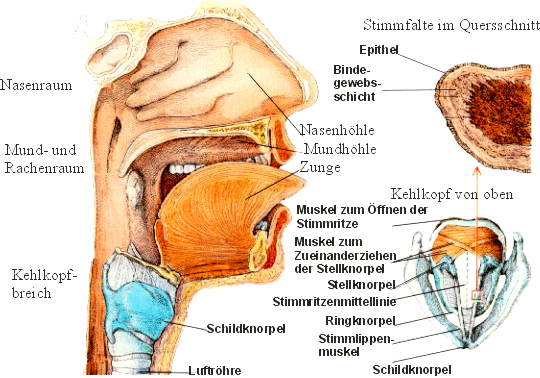
Abb. 4.1. Anatomie des Stimmapparates
4.1 Die Anatomie des Stimmapparates
Der Kehlkopf oder Larynx (Adj. laryngal) ist ein System von Knorpeln, die
durch Muskeln und Bänder miteinander verbunden sind. Die wichtigsten Teile des Knorpelskeletts
sind der große Schildknorpel (der als Adamsapfel äußerlich sichtbar ist, engl. thyroid
cartilage), der tiefer liegende Ringknorpel (engl. cricoid cartilage)
und die beiden innen gelegenen kleinen pyramidenförmigen Stellknorpel (Aryknorpel,
engl. arytenoid cartilages).
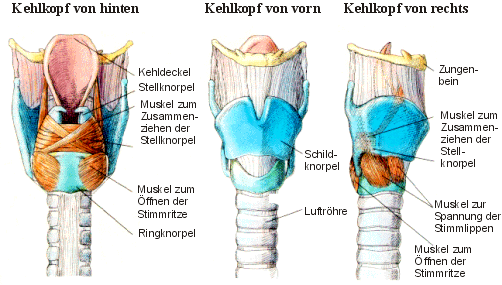
Abb. 4.2. Der Kehlkopf
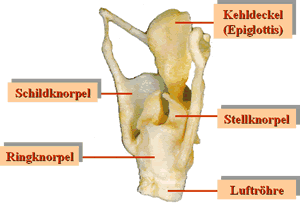
Abb. 4.3. Die Knorpel des Kehlkopfes
Die primäre biologische Funktion des Kehlkopfes ist jedoch nicht die Phonation,
sondern die Kontrolle des Luftweges von außen zur Lunge und umgekehrt von der Lunge
nach außen als Teil des Atmungsprozesses. Er hat außerdem eine Schutzfunktion, indem
er verhindert, daß feste oder flüssige Nahrung in die empfindlichen Lungengewebe
gerät bzw. dafür sorgt, daß durch einen komplizierten Vorgang, den wir Husten nennen,
Fremdkörper aus der Lunge entfernt werden.
Das wichtigste Organ für den Phonationsprozeß stellen die Stimmlippen oder Stimmfalten
(engl. vocal cords, vocal folds) dar.
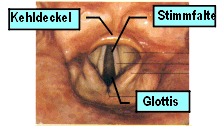
|
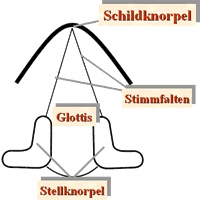
|
|
Abb. 4.4. Kehlkopf in vivo
|
Abb. 4.5. Stellung der Glottis
(schematisch)
|
Definition 4.2. Stimmlippen, -falten
Die Stimmlippen (auch Stimmbänder oder Stimmfalten genannt) bestehen aus zwei Muskelfalten
, die von einem gemeinsamen Ausgangspunkt an der Innenseite des vorderen Teils des
Schildknorpels ("Adamsapfel") nach rückwärts bis zu den Vorderenden eines
beweglichen pyramidenförmigen Knorpelspaares, die Stellknorpel, verlaufen. Die Stimmlippen
sind äußerst flexibel und können durch die Tätigkeit der mit ihnen verbundenen Knorpel
und Muskeln verschiedene Gestalt annehmen.
Der Raum zwischen den beiden Stimmlippen und den Stellknorpeln, die Stimmritze,
wird glottis genannt.
Definition 4.3. Glottis
Mit Glottis bezeichnet man den Raum zwischen den Stimmlippen und den Stellknorpeln
(engl. arytenoid cartilages). In manchen Fällen ist es zweckmäßig, zwischen
dem muskulösen (durch die Stimmfalten gebildeten) und dem knorpeligen Teil der Glottis
zu unterscheiden.
Wie bereits erwähnt, kann die Glottis eine Reihe unterschiedlicher Zustände aufweisen,
deren Form und Wirkung in den folgenden Abschnitten erläutert werden soll.
4.2 Atemstellung (Stimmlosigkeit)
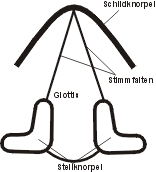
Abb. 4.6. Atemstellung
Am einfachsten läßt sich die Stellung der Glottis beim Atmen beschreiben. Sowohl
die Stimmlippen als auch die Stellknorpel liegen in ihrer ganzen Länge auseinander,
so daß ein Lungenluftstrom relativ ungehindert entweichen kann. Beim normalen Ausatmen
liegen sie etwas enger beeinander als beim Einatmen. Soweit bekannt, ist die Stellung
der Glottis bei stimmlosen Lauten die gleiche wie beim Ausatmen.
Ein typischer Laut, der mit dieser Glottisstellung gebildet wird, ist das stimmlose
/h/, bei dem auch die Artikulationsstelle glottal ist. Im übrigen ist diese Glottisstellung
die Grundlage für alle stimmlosen Laute, wie z.B. [p, t, k, f, s,
S, x ...]. Manche stimmlose Laute haben kein eigenes phonetisches Symbol,
z.B. weil sie Varianten von typischerweise stimmhaften Lauten sind (z.B. Nasale,
Liquide und Vokale). In diesen Fällen wird ein kleiner Kreis als zusätzliches diakritisches
(=unterscheidendes) Zeichen verwendet: [m ̥] und [n ̥] z.B. sind stimmlose Varianten der Nasale [m] und [n].
Haben die fraglichen Buchstaben Unterlängen, schreibt man das Zusatzzeichen besser
über das Hauptsymbol: [ŋ˚]
4.3 Stimmstellung
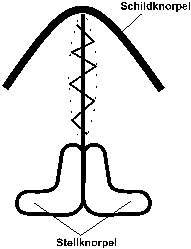
|
|
Abb. 4.7. Stimmstellung
|
Bei der Bildung von stimmhaften Lauten, d.h. bei Vokalen wie [a e i o u] oder Resonanten
wie [m n l j w], sind die Stimmlippen so angeordnet, daß sie sich in ihrer gesamten
Länge fast berühren. Wenn durch diese sehr enge Annäherung ein egressiver pulmonischer
Luftstrom geschickt wird, bilden sich Kräfte, durch deren Zusammenspiel dieser Luftstrom
in eine Folge von periodischen Pulsen verwandelt wird. Dieser Vorgang soll im folgenden
etwas genauer betrachtet werden.
|
|
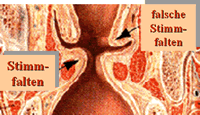
|
|
4.8. Längsschnitt durch den Kehlkopf
|
Abb. 4.9. Stimmfalten
|
Phasen der Phonation
|
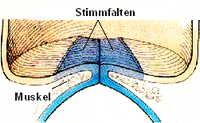
Abb. 4.10.
|
Abb. 4.10. und die folgenden Abbildungen zeigen das Öffnen und Schließen der Glottis
aus der Perspektive von vorn auf den Kehlkopf, die Stimmfalten sind zudem in der
Mitte quer angeschnitten..In der Ruhe oder zu Beginn eines Phonationszyklus berühren
sie sich.
|
|
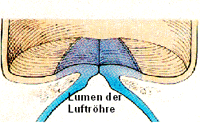
Abb. 4.11.
|
Drückt die Atemluft von unten gegen die Stimmfalten entsteht ein subglottaler Druck,
der bei Erreichen eines Schwellwertes diese auseinanderpreßt. Dabei trennen sich
zunächst die unteren Ränder.
|
|
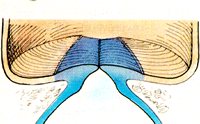
Abb. 4.12.
|
Später trennen sich auch die oberen Ränder.
|
|
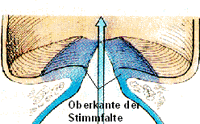
Abb. 4.13.
|
Sind die Stimmfalten geöffnet, kann die Atemluft wie durch eine Düse in den Rachenraum
entweichen.
|
|
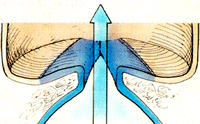
Abb. 4.14.
|
Durch diese schnelle Strömung entsteht jedoch eine seitliche Sogwirkung, der sog.
Bernoulli Effekt, der die Stimmlippen, unterstützt durch deren Elastizität, quasi
ansaugt und zusammenzieht.
|
|
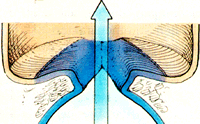
Abb. 4.15.
|
Dabei schließen sich zuerst die unteren Ränder, die oberen folgen, wenn der subglottale
Luftstrom abgeschnitten ist.
|
|
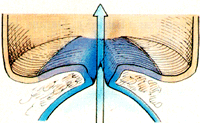
Abb. 4.16.
|
|
|
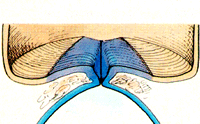
Abb. 4.17.
|
Als Folge davon wird unterhalb der erneut Glottis ein Druck aufgebaut, der sie den
Phonationszyklus von vorne beginnen läßt. Auf diese Weise wiederholt sich dieser
Zyklus immer wieder und erzeugt die regelmäßige Vibration, die wir Stimme nennen.
Die Vibrationsgeschwindigkeit und damit die Stimmhöhe eines stimmhaften Lautes hängt
von der Spannung der Stimmlippen ab, die von der Kehlkopfmuskulatur kontrolliert
wird.
|
|
|
|
Hinweis: Die folgenden Animationen und Videos können nur angezeigt und abgespielt
werden, wenn auf dem Rechner ein Quicktime "Plugin" vorhanden ist. Gegebenenfalls
müssen Sie es aus dem Internet herunterladen und installieren.
|
|
|
Abb. 4.18. Phonationsphasen animiert
|
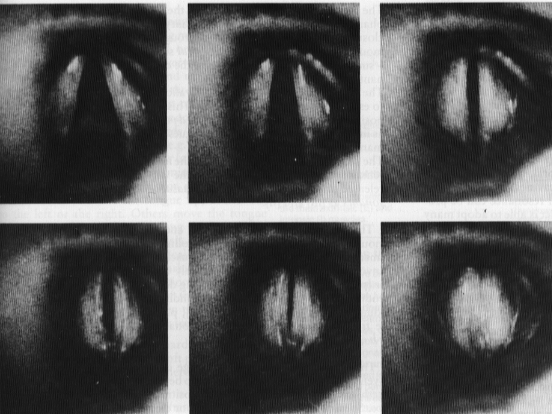
|
|
Abb.4.19. Die Bewegung der Stimmlippen
|
|
|

|
|
|
Abb. 4.20. Stimmbildungs-Beispiele
|
Durch die beien Phonationtypen "Stimmhaftigkeit" und "Stimmlosigkeit"
werden zwei Klassen von phonetischen Segmenten (phonetische Kategorien) definiert,
die Klasse der stimmhaften Segmente und die Klasse der stimmlosen Segmente. Da auf
der systematischen Ebene alle Segmente entweder stimmhaft oder stimmlos sind, können
wir Stimmlosikeit als Abwesenheit von Stimmton definieren. Stimmhafte Laute werden
dann durch das Merkmal [+stimmhaft] beschrieben, stimmlose Laute durch das Merkmal
[–stimmhaft].
[+stimmhaft]: /b, d, g, m, n, ŋ, v, z, ʒ, l, r, j / und
Vokale
Ebbe, Ede, Egge, Emma,
Anna, Anger, Slave, reisen,
Massage, Wille, Karren, Jagen
...
[–stimmhaft]: /p, t, k, pf, f, s, ʦ, θ, ʃ, x /
Pappe, Wette, Ecke,
Napf, Strafe, reißen, Zecke,
engl. thick, Lasche, Wache.
4.4. Stimmeinsatz-Zeit
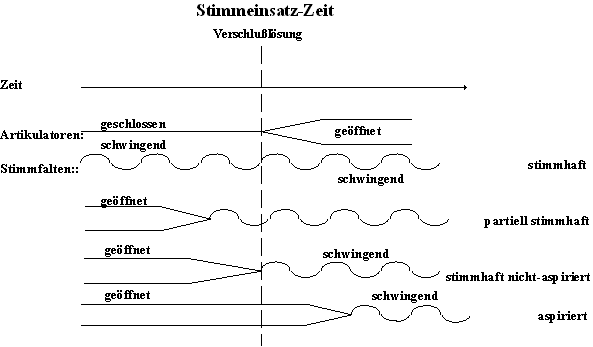
Abb. 4.21. Stimmeinsatz-Zeit
Im vorhergehenden Abschnitt wurde davon ausgegangen, daß phonetische Segmente entweder
stimmhaft oder stimmlos sind. Von einem im engeren Sinne phonetischen Standpunkt
aus betrachtet ist dies nicht ganz korrekt. Die Begriffe stimmhaft und stimmlos
beziehen sich auf spezifische Zustände der Stimmlippen während der Artikulation
eines Lautes. Die Dauer dieser Zustände muß jedoch nicht mit den Segmentgrenzen
zusammenfallen, d.h. eine Periode der Stimmhaftigkeit (oder Stimmlosigkeit) kann
länger oder kürzer sein als die Länge eines Segmentes. Wenn sich die Stimmfalten
nur während eines Teils der Artikulation in Stimmstellung (oder umgekehrt in Atemstellung)
befinden, ist das betroffene Segment partiell stimmhaft (bzw. stimmlos). Anlautendes
englisches /b/ z.B. ist partiell stimmhaft, während das entsprechende französische
/b/ immer voll stimmhaft ist.
Durch den Begriff der Stimmeinsatz-Zeit läßt sich auch das Phänomen der Aspiration
erklären. Unter Aspiration versteht man eine Phase der Stimmlosigkeit unmittelbar
nach der Lösung eines Verschlusses. Anders ausgedrückt, die Stimmfalten beginnen
erst eine Weile nach der Verschlußlösung wieder zu schwingen. Im Englischen und
Deutschen z.B. sind die stimmlosen Plosivlaute /p, t, k/ im Silbenanlaut vor betontem
Vokal aspiriert. In der phonetischen Umschrift wird Aspiration durch ein hochgestelltes
/h/ wiedergegeben: z.B. [ph,
th, kh].
4.5. Weitere Stellungen der Glottis
Neben den beiden fundamentalen Glottisstellungen Stimmstellung und Atemstellung,
mit denen wir uns im weiteren Verlauf hauptsächlich beschäftigen werden, gibt es
noch weitere Stellungen der Glottis, die linguistisch mehr oder weniger marginal
sind.
4.5.1. Flüsterstellung
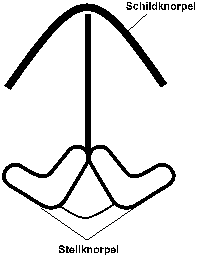
|
Wenn man bewußt vom normalen Ausatmen zum Flüstern wechselt, kann man im Kehlkopf
eine Anspannung verspüren, die beim Atmen fehlt. Man kann zwar mehrere Arten des
Flüsterns unterscheiden. Für den Augenblick jedoch genügt es festzustellen, daß
Flüstern ein kräftiges zischenedes Geräusch ist, das durch einen turbulenten Luftstrom
durch eine stark verengte Glottis hervorgebracht wird. In geflüsterter Sprache sind
normalerweise stimmhafte Laute geflüstert, während normalerweise stimmlose Laute
stimmlos bleiben. Wenn man z.B. Wörter wie fish oder six flüstert,
kann man feststellen, daß in der Tat nur der Vokal geflüstert wird, während die
Konsonanten stimmlos bleiben. Im Gegensatz dazu werden beim Flüstern des Wortes
vision alle Laute durch Flüstern ersetzt werden. Anders bei fission:
wenn man beide Wörter hintereinander flüstert, tritt der Unterschied zwischen Flüstern
und Stimmlosigkeit klar hervor.
In keiner bisher bekannten Sprache scheint es systematische geflüsterte Laute zu
geben.
|
|
Abb. 4.22. Flüsterstellung
|
|
4.5.2. Murmelstimme
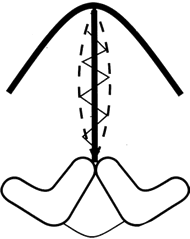
Abb. 4.23 Murlmelstimme
Manche Laute können nicht ausschließlich durch den Gegensatz zwischen stimmhaft
und stimmlos charakterisiert werden. Es gibt Sprachen mit zwei Vokalreihen, bei
denen jeweils die Stimmfalten schwingen. Eine Vokalreihe wird mit einer Glottisstellung
erzeugt, die der Stimmstellung entspricht. Die andere Reihe wird mit einer anderen
Konstellation der Stimmlippen produziert, bei der der knorpelige Teil der Glottis
(zwischen den Stellknorpeln) geöffnet ist, während der muskulöse Teil sich in Stimmstellung
befindet. Dadurch entsteht quasi eine Kombination von Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit.
Das Englische /h/ zwischen Vokalen (wie in ahead [əɦɛd])
ist von dieser Qualität. In der phonetischen Beschreibung indischer Sprachen wird
die Murmelstimme traditionell stimmhafte Aspiration genannt. In der phonetischen
Umschrift kann dieser Phonationstyp durch ein subskribiertes Trema oder ein hochgestelltes
[ɦ] gekennzeichnet: [m- z- b-
a-] bzw. [mɦ
zɦ bɦ aɦ]
4.5.3. Knarrstimme
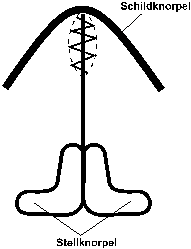
Abb. 4.24 Knarrstimme
Eine andere Erscheinungsform der Vibration der Stimmfalten findet sich in laryngalisierten
Lauten. Dabei ist der knorpelige Teil der Glottis fest geschlossen, während ein
Teil der muskulösen Glottis offen ist und mit geringer Amplitude vibriert. Häufig
sind sogar einzelne Glottisschläge wahrnehmbar, da auch die Schwingungsfrequenz
sehr niedrig ist (zwischen 90 und 40 Hz). Man nennt diesen Phonationstyp auch Knarrstimme
(engl. creaky voice).
In der phonetischen Umschrift wird die Laryngalisierung durch eine subskribierte
Tilde gekennzeichnet: [m̰ b̰ z̰ a̰]
4.5.4. Glottisverschluss
Bei der Bildung eines Glottisverschlusses (engl. glottal stop) werden die
Stimmlippen in ihrer gesamten Länge fest zusammengepreßt. Von einem systematischen
(phonologischen) Standpunkt aus betrachtet muß der Glottisverschluß als Artikulationstyp
aufgefaßt werden. Vom phonetischen Gesichtspunkt aus ist er jedoch ein Stellungstyp
der Glottis, der komplementär zu anderen Glottisstellungen ist. Liegt ein glottaler
Verschluß vor, kann es gleichzeitig weder Stimmhaftigkeit, noch Stimmlosigkeit,
noch irgend einen anderen Phonationstyp geben.